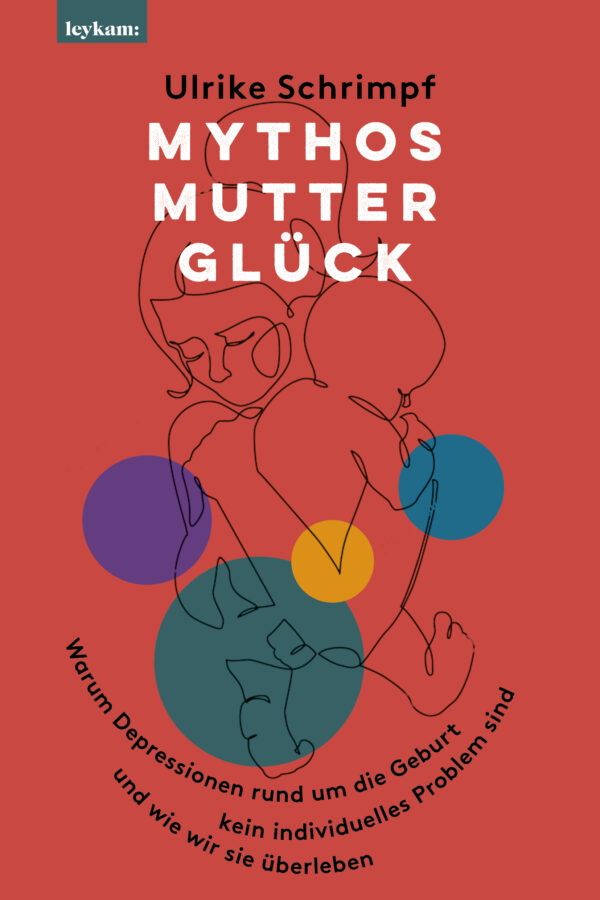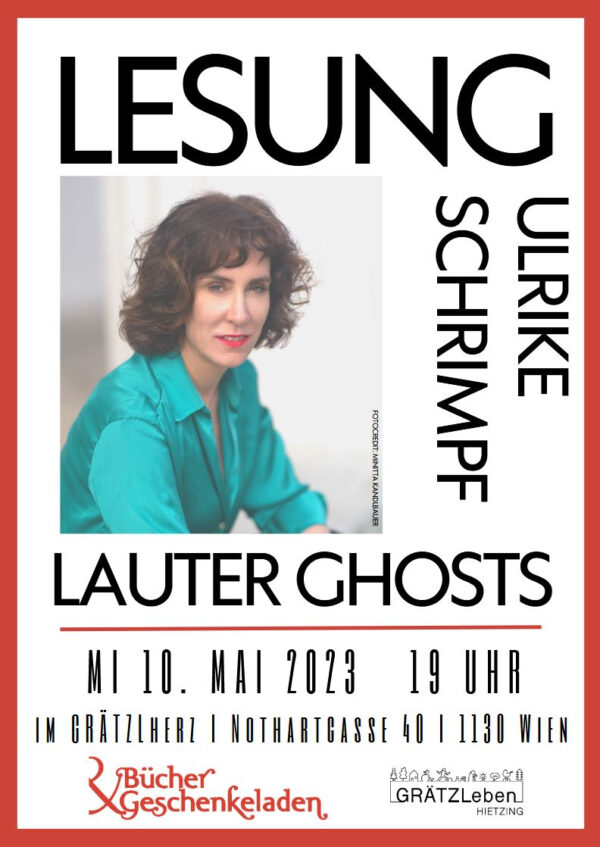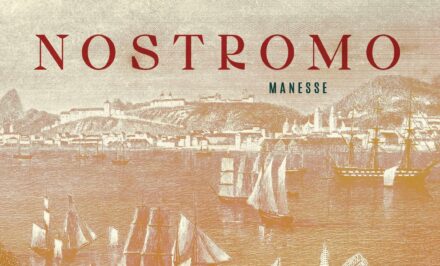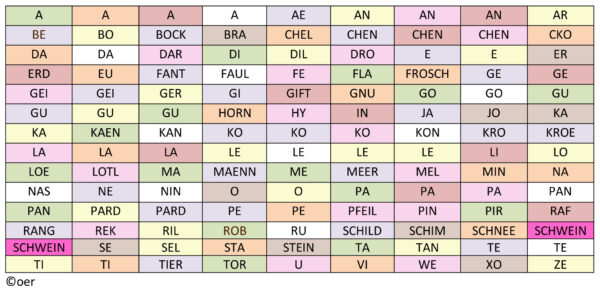Sprache, Form und Dichtung. engramme. dinge ohne augen zeugen. gedichte zu den arolsen archives – von Ulrike Schrimpf
Dieser Text ist ein Vortrag, den die Schriftstellerin Ulrike Schrimpf für ein Symposium an der Folkwang Universität Essen und für Studierende im Bereich „Design / Buch- und Textgestaltung“ geschrieben hat. Wir veröffentlichen ihn mit ihrer freundlichen Erlaubnis. Hier geht es bei uns zu ihrer Besprechung von Andreas Pflügers „Wie Sterben geht“ und großen Gespräche mit Ulrike Damm, Tanja Schwarz und Steve Rasnic Tem bei uns hier. – D. Red.
** **
Das, was ich tue, das, was ich leidenschaftlich gerne und schon lange in meinem Leben tue, ist Schreiben.
Ich schreibe total intuitiv, aus Gefühlen, Eindrücken und Bildern heraus, nicht weil ich mir etwas vorgenommen, überlegt oder weil ich etwas reflektiert habe.
Obwohl ich einen wissenschaftlichen Hintergrund habe, gehe ich beim Schreiben also gänzlich irrational vor in dem Sinne, dass ich nicht überlege, was könnte Andere interessieren? Was ist angesagt? Was ist erfolgversprechend? Was hat eine große Zielgruppe? Oder auch: Was begeistert die Kritiker:innen? Was könnte mir Anerkennung einbringen?
Ich schreibe schlicht und einfach über die Dinge, Menschen, Gefühle, Erlebnisse, Erfahrungen, die mich persönlich bewegen und interessieren, und ich tue das, weil ich es nicht anders kann.
Denn jedes Mal, wenn ich versuche, etwas zu schreiben, von dem ich mir vorstelle, dass es Anderen gefallen könnte, das mir selbst aber nicht hundertprozentig entspricht, scheitere ich. Jedes Mal entsteht dann ein halbherziger, unechter, geschummelter, auf faulen Kompromissen basierender, zwar formal und stilistisch solider, aber lebloser Text.
Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen diesbezüglich sind, wie und aus welchen Beweggründen Sie gestalten und auf welche Weise, aber ich würde mich sehr freuen, mich dazu mit Ihnen auszutauschen.
Ich persönlich habe die gerade beschriebene Erfahrung gemacht, zu der eine zweite gehört, die für mich wesentlich ist: Wenn ich in meine Schreibprojekte nicht immer und integral die Möglichkeit miteinschließe, dass ich mit und in ihnen scheitern könnte, auch grandios scheitern, werden sie nicht gut.

Als ich als junge Studentin Anfang 20 am Szondi-Institut der Freien Universität Berlin Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft zu studieren begann, war ich ziemlich naiv und gänzlich unbeleckt von wissenschaftlicher Theorie. Nachdem ich mich ein paar Jahre lang ziemlich erfolglos dem Theater und Schauspiel gewidmet hatte, hatte ich begonnen, VWL zu studieren, weil ich nun, anstatt Kunst zu machen, die Welt retten wollte und mich dafür in Wirtschaft auskennen musste, so war meine Vorstellung. Das Studium aber brach ich schon nach ca. drei Wochen wieder ab, weil es mich unsäglich langweilte.
Also kellnerte, lebte, liebte und feierte ich bis zum nächsten Semester und begann dann, AVL und Französische Philologie zu studieren, einfach, weil ich immer schon leidenschaftlich gern, ja, zeitweise wie besessen las, und weil ich ein Talent für Sprachen hatte. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich damit befasst, was das Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft eigentlich beinhaltet und umfasst. Mir war auch nicht klar, dass es ein ausgesprochenes Intellektuellen-Fach an der Freien Universität war und ist, für das man damals einen Notendurchschnitt von 1,0 brauchte, um es zu studieren.
In der Schule hatte ich immer alles mühelos verstanden und gemeistert. Jetzt aber saß ich plötzlich wie eine scheue Maus in den Vorlesungen und Veranstaltungen zur Literatur- und Übersetzungstheorie, zu Philosophie, Linguistik und Sprachgeschichte und Sprachphilosophie, bekam den Mund nicht auf und fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben: dumm. Eine unangenehme Erfahrung. Vielleicht wissen Sie, was ich meine. Vielleicht aber auch nicht.
Ich hatte mir bis zu dem Zeitpunkt nie wirklich die Frage gestellt, warum ich bestimmte Literatur mochte und warum andere nicht. Ich hatte Literatur einfach gelebt, d.h. ich hatte mich in sie hineinversenkt und mich total mit ihr identifiziert. Jetzt plötzlich, an der Uni, erfuhr ich, dass man das nicht durfte, dass Identifikation banausenhaft war und kein legitimer Weg, sich Literatur oder Kunst i.A. anzunähern. Ich kann Ihnen versichern, ich habe damals einiges gelernt und dann auch einige Zeit lang daran geglaubt, von dem ich heute aus meiner Lebenserfahrung heraus und auch aus künstlerischer Sicht weiß, dass es Unfug ist.
Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt auch noch nie ernsthaft, fundiert und differenziert, die Frage gestellt, wie Gehalt und Form in der Kunst zusammenhängen, wie und warum also bestimmte formale und stilistische Kriterien, in der Literatur z.B. Sprache, Rhythmus, Pausen, Absätze, verschiedene Schriftarten, Versformen etc., den Gehalt des Ausgedrückten beeinflussen bzw. wie das Wechselspiel funktioniert zwischen dem, was ich erzähle, und dem, wie ich es erzähle, und wie dann letztlich Dichtung bzw. Literatur daraus entsteht.
Dazu habe ich an der Universität und mit Lehrenden einige wertvolle Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte. Erfahrungen, die mein Verständnis von Kunst geprägt und mich in meinem späteren künstlerischen Leben als Schriftstellerin begleitet haben.
Von zwei dieser Erfahrungen möchte ich Ihnen erzählen, weil sie beide mit der Wirkungskraft von Kunst und mit dem Zusammenhang von Sprache, Form und Dichtung zu tun haben.

Ich hatte in der AVL eine bemerkenswerte Professorin, Frau Prof. Hella Tiedemann, Komparatistin und Romanistin in der Tradition der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule, auch Herausgeberin einiger wesentlicher Schriften von Walter Benjamin. Abgesehen von der Tatsache, dass sie eine hervorragende Wissenschaftlerin war, war sie eine begnadete Lehrende und hat mich nachhaltig auch menschlich beeindruckt.
In ihren Seminaren rauchte sie, zumindest in der Anfangszeit, noch Kette, später dann war das verboten, und sie überzog jedes Mal gnadenlos, bis zu einer Stunde und mehr. Das Wunder war: Alle Studierenden blieben. Niemand ging. Ganz egal, welches Seminar man in Folge verpasste und welchen Ärger man sich einhandelte: Wenn Hella Tiedemann ihr Seminar noch nicht beendet hatte, blieb man. Weil es immer lebendig, spannend und kontrovers, war: was sie erzählte, aber auch, was sie in den Studierenden auslöste und bewegte.
Hella Tiedemann begegnete uns Studierenden auf Augenhöhe, nahm uns ernst und tat alles Mögliche, in ihren Kräften Stehende, um uns zu unterstützen. So kann ich mich an einen Anruf von ihr bei mir zu Hause erinnern, nachdem ich ein Referat über Adornos Ästhetische Theorie gehalten hatte, für den ich am Institut heftig angegriffen worden war, weil ich es gewagt hatte, Kritik an Adorno zu üben, einem der Hausgötter am Szondi-Institut.
Ich war damals wie vom Donner gerührt, dass meine Professorin mich zu Hause anrief. Im Folgenden führte sie ein ausführliches Gespräch mit mir, indem sie mir sagte, ich hätte mich wie ein kleiner Punk aufgeführt, das habe ihr gefallen und sie an sich selbst erinnert, als sie so alt gewesen sei wie ich. Hella Tiedemann tröstete mich und bestärkte mich darin, mir mein eigenständiges, auch widerständiges Denken zu erhalten. Das habe ich – ihr – nie vergessen.
Sie war es auch, die eines Tages in einem ihrer Seminare ein Gedicht von Rilke zitierte, den ich persönlich bis heute nicht besonders leiden kann. Aber dieses Gedicht hat seitdem und für immer seinen besonderen Wert für mich:
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
Rilke beschreibt in dem Gedicht ein Kunstwerk und einen Rezipienten oder eine Rezipientin: einen Jünglingstorso aus Stein, der den Betrachtenden schwer beeindruckt und bewegt. Mit und in seiner Kunst ist der Torso, eigentlich ein lebloses Objekt, total lebendig: Er glüht, schaut, glänzt, blendet, lächelt, zeugt (Kunst!), flimmert, bricht aus (wie ein Stern), sieht den Betrachtenden von allen seinen Punkten aus und vermittelt ihm oder ihr nicht weniger als:
Du musst dein Leben ändern.
Offensichtlich geht es hier um die lebensverändernde Kraft und Macht, die Kunst im besten Falle auf uns ausüben kann.
Kafka hat später Ähnliches, allerdings entschieden dunkler, mit dem vielberufenen und mittlerweile etwas abgegriffenen Zitat von der „Axt im Eismeer“ beschrieben, die ein Buch sein solle:
“Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? (…) Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.”

In dem Moment, als Frau Prof. Tiedemann das Gedicht von Rilke zitierte, wurde mir mit einem Mal klar, dass ich Literatur nicht nur las, weil sie mich unterhielt, mir die Zeit vertrieb, mich ablenkte und in anderen Welten versinken ließ, sondern auch, weil sie, eine einschneidende, prägende und vielleicht sogar lebensverändernde Wirkung auf mich und andere haben konnte.
Ich persönlich glaube, dass das vor allem der Fall ist, wenn Form, Sprache und Gehalt sich in einem Kunstwerk zu einer untrennbaren, sich gegenseitig unterstützenden, be- und verstärkenden oder auch sich gegen- und aneinander reibenden Einheit verdichten.
Wir können und dürfen also in allem, was wir künstlerisch ausdrücken, zeigen und schaffen wollen, weder die Form noch den Gehalt vernachlässigen, und beide müssen auf essenzielle Art und Weise miteinander verbunden sein. Nur so und erst dann entsteht gute Dichtung.
Das Gedicht von Rilke ist übrigens ein Sonett, eine der anspruchsvollsten lyrischen Formen überhaupt. Grob gesagt besteht sie in der Regel aus zwei Quartetten und zwei Terzetten, für die jeweils ein bestimmtes Versmaß und Reimschema vorgesehen sind.
Eine solche strenge dichterische Form kann eine fruchtbare Verbindung mit dem Gehalt eines Textes eingehen, wenn beide einander bedingen und sich organisch und gewissermaßen zwingend ergänzen und miteinander verbinden.
Wird die Form allerdings vor allem der Form halber gewählt in dem Sinne, dass der oder die Schreibende sich denkt: Ich will etwas Anspruchsvolles, Intellektuelles schreiben, habe aber im Grunde keine Ahnung, was ich sagen, erzählen oder zeigen will, egal, die Form wird’s schon richten, dann entsteht ein artifizielles und tendenziell leeres Luftkonstrukt.

Der Dichter Robert Gernhardt nimmt diese Art von Formverliebtheit – Form um der Form willen – in einem Gedicht, natürlich einem Sonett!, das ich liebe, auf’s Korn. Ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten:
Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs
Sonette find ich sowas von beschissen,
so eng, rigide, irgendwie nicht gut;
es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen,
dass wer Sonette schreibt. Dass wer den Mut
hat, heute noch so’n dumpfen Scheiß zu bauen;
allein der Fakt, dass so ein Typ das tut,
kann mir in echt den ganzen Tag versauen.
Ich hab da eine Sperre. Und die Wut
darüber, dass so’n abgefuckter Kacker
mich mittels seiner Wichserein blockiert,
schafft in mir Aggressionen auf den Macker.
Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert.
Ich tick es echt nicht. Und wills echt nicht wissen:
Ich find Sonette unheimlich beschissen.
Die zweite Szene mit Hella Tiedemann, von der ich Ihnen erzählen möchte, war ein Moment, in dem wir ein Gedicht analysierten, ich weiß leider nicht mehr, welches. Es war aber auf jeden Fall eines, das sich reimte, also vermutlich eher ein klassisches, traditionelles.
Wir analysierten die Struktur und Form des Gedichts wie man das eben so macht, und an einer Stelle sagte Frau Tiedemann, nachdem sie eine Strophe klangvoll vorgelesen hatte: „Merken Sie das? Die Reime affizieren hier die Wörter.“ Sie meinte damit, dass die Reimwörter, die Art und Weise, wie sie klangen, und ihre Form (waren sie lang oder kurz, einsilbig oder mehrsilbig, männlich stumpf oder weiblich klingend etc.), sich in dem Gedicht unmittelbar auf den Gehalt auswirkten, also auf das, was gesagt und erzählt wurde. Die Form beeinflusste und veränderte also den Inhalt.
Das war für mich damals eine völlig neue und auch faszinierende Erkenntnis: dass eine künstlerische Form eine solche transformative Kraft und Macht auf die Semantik, auf die Bedeutung, haben konnte. Diese in dem Moment für mich neue, im Grunde aber natürlich schlichte und auch naheliegende Erkenntnis eröffnete mir neue Sichtweisen auf die Literatur der Moderne und der Postmoderne bis heute, und ich bin mir sicher, dass sie mich später, als ich selbst mit dem Schreiben von Lyrik begann, untergründig begleitet hat und bis heute begleitet.
Wie ist nun mein Zyklus engramme. dinge ohne augen zeugen. gedichte zu den arolsen archives entstanden, den Sie zu meiner großen Freude in diesem Semester gestalten werden?
Der Begriff „Engramm“ stammt aus dem Griechischen von den Wörtern „en“, was „hinein“ bedeutet, und „gramma“ = „Inschrift“. Er wird allgemein verwendet, um eine physiologische Spur zu bezeichnen, die eine Reizeinwirkung als dauernde strukturelle Änderung im Gehirn hinterlässt. Die Gesamtheit aller Engramme – es sind Milliarden – ergibt dabei das Gedächtnis. Bei jeder Handlung und jeder Situation greift das Gehirn auf Engramme zurück.
Im Falle des Zyklus` war es wiederum nicht so, dass ich dachte, ich will Gedichte zur Judenverfolgung im 3. Reich schreiben, denn das ist ein relevantes, wesentliches Thema oder Ähnliches.
Im Gegenteil, als ich wusste, dass ich diesen Zyklus schreiben wollte – ich weiß so etwas immer sehr intuitiv, stark und plötzlich -, dachte ich: Aber muss es ausgerechnet zu diesem Thema sein? Inwiefern hast du als Nicht-Jüdin und Deutsche überhaupt die Legitimation, dich dieser Geschichte gewissermaßen zu bedienen, um Gedichte zu schreiben? Du wirst dir womöglich Ärger einhandeln… etc.
Mein Drang, die Gedichte zu schreiben, war allerdings stärker als alle Skrupel. Es handelte sich dabei um einen Drang, der von Dingen hervorgerufen wurde, die ich im Sommer 2022 in einer Wanderausstellung der Arolsen Archives gesehen hatte.


Die Arolsen Archives 
Die Arolsen Archives sind ein in Hessen situiertes internationales Zentrum zu Opfern des NS-Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Dokumente zur NS-Verfolgung zu bewahren und international zugänglich zu machen. In der besagten Wanderausstellung waren Fotografien von Objekten ausgestellt, die die Menschen, die in Arbeits- oder Konzentrationslager interniert wurden, bei sich trugen, und die ihnen dort von den Nazis abgenommen wurden: Uhren, Ringe und anderer Schmuck, Puderdosen, Briefe, Fotos, solche Dinge.
Die Fotografien haben mich tief berührt und bewegt. Auch das ist etwas, das mich, seitdem ich denken und mich erinnern kann, beschäftigt: die Geschichten, die Dinge und Objekte erzählen.
Die Faszination, die von Gegenständen ausgeht, habe ich zum ersten Mal als kleines Mädchen erlebt, immer, wenn ich mich in dem Arbeitszimmer meines Vaters und an seinem Schreibtisch aufhielt.
Er war ein Gymnasiallehrer und schrieb ebenfalls, wie ich, hat nur nie etwas publiziert, sein Leben lang nicht. Auf seinem Schreibtisch sammelten sich allerhand seltsame, bemerkenswerte Gegenstände: Vogelfedern, Versteinerungen, Murmeln, Muscheln, eine angebrochene Kachel, ein Elch aus Messing.
Ich weiß noch wie heute, wie ich diese Gegenstände wieder und wieder in die Hand nahm und sie betrachtete. Wie ich mir vorstellte, warum mein Vater sie aufhob, was sie ihm bedeuteten, von wem er sie geschenkt bekommen hatte usw. Ich erinnere mich ganz genau, auch körperlich, daran, wie ich damals den Geschichten zuhörte, die die Objekte auf dem Schreibtisch meines Vaters mir erzählten: über meinen Vater, aber auch über sich selbst und das Leben insgesamt. Und über mich.
Als ich jetzt in der Wanderausstellung der Arolsen Archives die letzten privaten Gegenstände sah, die die Menschen bei sich trugen, bevor sie endgültig jede Freiheit und aller Wahrscheinlichkeit nach auch ihr Leben verloren, entstanden sofort wieder Geschichten in mir.
Ich begann zu recherchieren und befasste mich eingehender mit den Arolsen Archives, mit seinem gewaltigen Archiv, online und vor Ort, und mit seinen Publikationen. Auf diesem Weg entstanden die neun engramme-Gedichte. Es sind Gegenstände, die mich zu ihnen geführt haben: Aus und zu ihnen ist in Folge Dichtung entstanden, Sprache und Form.
In den Gedichten schreibe ich u.a. über ein Paar Ohrringe mit roten Steinen, das die 16jährige Helena Poterska trug, als sie auf ihrem Schulweg von Nationalsozialisten festgenommen und in das Konzentrationslager Posen gebracht wurde,
über ein Bernsteinarmband, das Wieslawa Brzyś gehörte, die in Bergen-Belsen in einer Rüstungsfabrik arbeiten musste,
über einen Abschiedsbrief, den der niederländische Widerstandskämpfer Peter Will an seine Frau und seine sechs Söhne schrieb, den er aber nicht mehr abschicken konnte,
über den Ehering des Norwegers Thorwald Michelsen,
über die Taschenuhr des belgischen Hauptmanns Edmond Ameye,
über die Zeichnungen, die der Bühnenbildner und Widerstandskämpfer Paul Goyard vom Lageralltag auf Abfallpapier festhielt,
über die Puderdose von Alexandra Belezka, in der ein Zettel mit einem darauf gekritzelten Namen und einer Adresse versteckt war, vermutlich eine Fluchtadresse
und über ein Dokument, das mich besonders berührt hat, weil ich selbst drei Söhne habe, die ich über alles liebe:
Es handelt sich dabei um ein Papier, in dem die Schauspielerin und Artistin Gitta Albrecht, zu den Sinti und Roma gehörend, 1951 ihren Sohn zur Emigration und Adoption freigab. Sie war im Lager an Tuberkulose erkrankt. Die Krankheit ließ sie seitdem nie mehr los und machte es unmöglich, dass sie sich um ihr Kind kümmern konnte. Schließlich führte die Tuberkulose zu Gitta Albrechts Tod.
Mit dem Gedicht zu der Adoptionsfreigabe von Gitta Albrecht möchte ich hier und heute schließen.
Vorher ist es mir ein Bedürfnis zu sagen, dass ich unglaublich gespannt bin, was Ihnen wie zu den engrammen einfallen wird, und wie Sie sie gestalten werden.
1000 Dank schon jetzt für Ihre Ideen, Ihre Gedanken, Ihre Zeit, Ihre Vorstellungskraft, Ihre Kunst!
schwindsucht
diese sucht zu schwinden hat sie
seitdem sie möglicherweise unter
kuppeln über ein seil balanciert ist
vielleicht hat sie dort aber auch
geschirr gewaschen oder karten
abgerissen oder du stellst dir das
nur vor eine asoziale zigeunerin
imaginierst du aber wer kann das
sein und warum hast du ein recht
dazu denn du hast die pflicht an eine
schwindsucht zu denken die sie nicht
mehr loslässt seitdem sie sich in eine
bloße nummer verwandelt hat 38949
wer kann sich das merken und wie
ist es möglich dass ein mensch striche
in seinem kopf verankert ein kochtopf
kopf ist das dann mit 3 8 9 4 9 zahlen
die sie auf dem boden festpresst in
allen nächten spürt sie das schlagen
von knochen gegen rahmen zu dem
sie diese eine zahlenfolge in die
gänge ihres gehirns drückt in ihr
kleines dummes in das verängstigt
denkende meißelt sie das sich wider
willen in anderem verkeilende so
dass man es festtackern muss rund
schnüren einschneiden sozusagen
imprägnieren solange bis sie nichts
mehr besitzt als die unter ihrer haut
angebrachte nummer-
wenn etwas vorbei ist ist in wahrheit
nichts vorbei und einbleibender
auswurf setzt sich an den strängen
des halses fest zieht den cervix in
knorpelseile auseinander der in
einem kastanientierkörper steckt
über den sie sachte ihre hände hält
auf fixierte felder gesunken nimmt sie
schriftzeichen in die hand von derjenigen
die sie seit diversen monden überfällt
und die außerstande war ihr kind zu
halten nicht einmal eine frisch geborene
kröte konnte sie aus eigener kraft
halten
ich bestätige hiermit, dass ich auf alle
Ansprüche, Rechte und Vorteile
hinsichtlich meiner Beziehung
zu dem besagten Kind
verzichte
- Ulrike Schrimpf wuchs in Berlin auf, studierte dort und in Paris Literaturwissenschaft, lebte und arbeitete seit 2010 als freie Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Dozentin in Wien. Sie hat drei Söhne, die Familie ist 2023 nach Augsburg umgezogen. Sie hat bislang den Roman „LAUTER GHOSTS“ und ein gleichnamiges Theaterstück geschrieben, zusammen mit Axel Holst den Erzählungsband »Blinde Versuche über das Töten: von Menschen«, zusammen mit der Künstlerin Johanna Hansen den Lyrikband »pariser skizzen. je te flingue«, sowie diverse Kinderromane und Sach- und Fachbücher. Ihre Internetseite hier.
Siehe auch von ihr bei uns:
Ein vertikaler Riss in der Wirklichkeit. Ein langes Interview mit Steve Rasnic Tem, CulturMag April 2024
„Auf den sich ausbreitenden Irrsinn sei zu achten.“ Ein Gespräch mit der Künstlerin und Schriftstellerin Ulrike Damm, CulturMag Februar 2024
Herzschlaglektüre: Was Tote träumen. Ulrike Schrimpf zu Andreas Pflügers Roman „Wie Sterben geht“, CulturMag Dezember 2023
Jan Kuhlbrodt „Krüppelpassion“, CulturMag November 2023
„Ich will runter in den Schacht.“ Tanja Schwarz‘ aktueller Roman „Vaters Stimme“. Ein Gespräch, CulturMag Oktober 2023