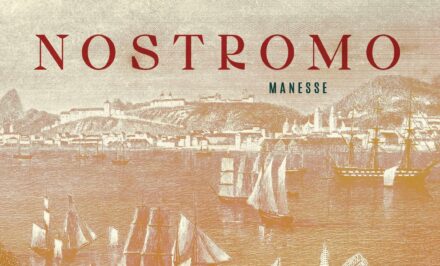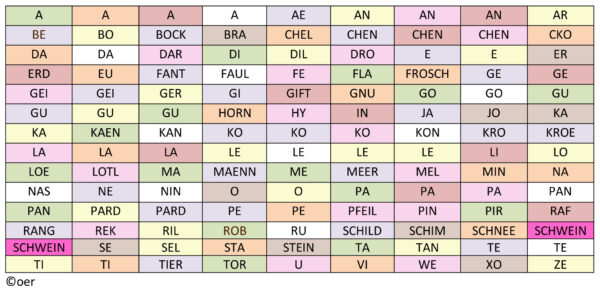The making of metro …
In memoriam Jac Flessenkemper
Metro – die weltumspannende Krimi-Reihe, die gar keine Krimi-Reihe war, sondern aus 155 spannenden Romanen aus aller Welt bestand, und die ich ab 1998 erfunden und bis 2007 in Kooperation mit dem Zürcher Unionsverlag herausgegeben habe – dieses metro also war, so konnte man zum Beispiel lesen, »die beste Krimi-Reihe Europas«, hat ein bisschen den Krimi-Markt in Richtung »Global Crime« gedreht und ein wenig Trend gesetzt. Metro fuhr ein paar zigtausend Rezensionen mit einem Lob-zu-Verriss-Quotienten von 9&2 ein, gab eine Art Blaupause für ähnliche verlegerische Konzepte (»Bitter Lemon« in England etwa) ab, verkaufte viele, viele Bücher, hat Preise galore eingeheimst und war eine recht angesehene und allseits erfolgreiche Veranstaltung. Man kann das alles nachlesen, das Internet ist eine Fundgrube, und das Pressearchiv des Unionsverlages steht Ihnen gerne hilfreich zur Seite …
Deswegen lassen wir jetzt den Weihrauch abziehen und gucken uns das ganze Spektakel etwas kühler an. Mit den Augen des Kritikers, der zum Praktiker wurde und dann wieder zum Kritiker. Was schon mal der erste spannende Aspekt an der ganzen Angelegenheit war …
Hinterher weiß man ja immer mehr, aber eines war klar: Bevor so etwas wie metro entstehen konnte, war es sinnvoll, eine Art »Erwartungshorizont« abzustecken. Also: Wie sind die Ressourcen des Partners, mit dem zusammen metro realisiert werden sollte, einzuschätzen? Die ökonomischen, vertrieblichen und intellektuellen Kapazitäten, die vermutliche Medienaufmerksamkeit und die Medienpräsenz, vor allem, wenn der erste Aufmerksamkeitsbonus verzehrt ist?
Das heißt nicht, dass es zunächst das metro-Konzept gab und dann dafür ein Partner gesucht wurde. Die Entstehungsgeschichte von metro ist Teil dessen, wie metro dann realisiert wurde. Gehen wir in die Zeit zurück, als metro noch nicht so hieß, noch gar nicht erdacht war. In der Mitte der 90er-Jahre veränderte sich das Verlagswesen radikal, besonders was die Genre-Literatur und da wiederum die Kriminalliteratur betraf. Am Ende der Kohl-Ära begann das große Fusionieren im Verlagswesen seine Folgen zu zeigen – betriebswirtschaftliche Modelle, nach denen jedes Buch ein »Profitcenter« sein sollte, killten die Mischkalkulation (erfolgreiche Titel finanzierten bis dahin notfalls qualitätsreichere, aber nicht so breit verkäufliche) und indirekt damit die meisten klassischen Krimireihen – Rowohlts schwarze, Ullsteins gelbe.
Dazu kam, dass die gesellschafts- und sozialpolitische Regression dieser Zeit mit einer kriminalliterarisch-ästhetischen Regression korrespondierte: Die Zeiten der Donna Leon und Henning Mankell begannen mit aller Wucht, den Status, den sich die Kriminalliteratur allmählich als Konkurrenz zur Hochliteratur erschrieben hatte – mit eigenen Mitteln, wohlgemerkt, nicht durch Assimilation, wie derzeit ‒, ins ästhetische und erkenntnistheoretische Neandertal zurückzubomben. Und natürlich wurden schlichte Konzepte und Rezepte gerne angenommen – wenn die Welt sonst gar nicht in Ordnung war, dann doch wenigstens im Kriminalroman.
Die Welt außerhalb von Venedig, außerhalb der schwedischen Countryside, außerhalb des Belly of the Serialkiller der Saison und zunehmend außerhalb der guten deutschen Heimat, diese Welt hatte man so gar nicht auf dem Schirm. Mit anderen Worten – Kriminalliteratur begann, sehr erfolgreich, sehr schlicht und sehr leer zu werden. Zumindest die Sorte Kriminalliteratur, die man auf unserem Markt bekommen konnte.
Es gab aber auch andere, und hier setzte metro an. Nach ein paar Zeitungsartikeln wider die unschönen Zustände auf dem deutschen Krimimarkt und nach ein paar interessanten und aufschlussreichen Gesprächen mit der assortierten Verlagslandschaft (die irgendwie grimm entschlossen schien, die Hand, die sie nun nicht abhacken konnte, fest zu schütteln), schien der Unionsverlag als Träger einer möglichen Reihe passend und sinnvoll. Dessen Profil: Literatur aus der buchstäblich ganzen Welt, minus einer gewissen iberophonen und anglophonen Kompetenz. Also günstig für den Unionsverlag, weil anglophone und iberophone Literatur per se einen stark kriminalliterarischen Akzent haben, insbesondere in Lateinamerika. Insofern verzahnte sich die metro-Idee aufs Schönste mit dem Bestand beim Unionsverlag und arrondierte das Gesamtbild.
Evidentermaßen wurde ja weltweit Kriminalliteratur geschrieben, die Ubiquität oder sagen wir: Die Globalisierung des Verbrechens und der wenig spezifische, aber dennoch global verständliche Code Crime-fiction brachte besonders interessante Literatur da hervor, wo Gesellschaften in Gärung oder im Umbruch waren (und sind): Yasmina Khadras Algerien, Pepetelas Angola, Mongo Betis Kamerun etwa. Oder wo urbane Gesellschaften immer dichter wurden: das vollgepackte Hongkong, in dem Stewart/Sloans Vampir »Temutma« (übrigens der allererste metro-Titel, vielleicht symbolisch: ein Vampirroman …) metaphorisch und buchstäblich umgeht; Istanbul, die Megacity, in der Celil Oker den ersten modernen Privatdetektiv der Türkei ermitteln lässt; Manila, Bangkok, Marseille, Barcelona – alles keineswegs zufällige Schauplätze von metro-Romanen. Sie waren ja alle da (Romane aus Kasachstan oder Sansibar, Indien oder der Mongolei waren leider zu schlecht geschrieben, um metro-kompatibel zu sein), man musste sie nur finden und zu einem Konzept bündeln. Das war das, was metro dann getan hat: die Akquise professionalisieren.
Und alle subgenrehaften Limits abschaffen. Bei metro war per definitionem alles möglich, von Freestyle über Hardboiled bis hin zum Cozy und alles, was in andere Genres hineinlappte: in Western (Gabriel Trujillo-Muñoz), Horror (Stewart/Sloan) und Abenteuer (Meja Mwangi), Crime-fiction bei metro war von Anfang an eine gezielt schubladenfreie Veranstaltung.
Aber zunächst einmal musste geklärt sein, wie man den Markt knacken könnte, der ja, siehe oben, recht neurotisch vor sich hin zickte. Erste Entscheidung: mit einer gewissen Massivität des Auftritts und zweitens mit Taschenbüchern. Masse, um dem Buchhandel zu demonstrieren, dass man’s ernst meinte; Taschenbücher wegen des Preises und aus der immer noch richtigen Überlegung, dass es eine Wertehierarchie zwischen Hardcover und Taschenbuch im substanziellen Sinn nicht ernstlich gibt. Eine hoch motivierte Verlagsvertreterschaft war für dieses Konzept weit mehr als hilfreich.
Das nächste Argument hieß Heinz Unternährer. Der hatte das geniale Design der Unionsverlags-Taschenbücher (UT) entwickelt und für metro, das in dieser ersten Phase noch UT metro hieß, einen weiteren genialen Dreh gefunden: nur silberne Schilder mit dem Wort »metro« auf dem Umschlag, sonst keine weiteren Differenzen zum anderen UV(= Unionsverlags)-Programm. Das war eingängig und unterstrich ein weiteres Grundaxiom von metro: Integration von Leserinnen und Lesern und nicht etwa Eröffnung eines abgeschlossenen, eng definierten »Krimi-Bezirks«, Also: Alle Leser sind willkommen, metro ist kein Nischenprogramm für eine spezielle Klientel, sondern soll Leute erreichen, die gerne gute Bücher lesen, egal, welches Label draufklebt. To make a long story short: Das integrative Modell hat funktioniert. Metro als Reihe konnte Profil entwickeln und war bald Sammlerobjekt.
Metro zog auch neues Publikum für Kriminalliteratur an. Das wenige, was man wirklich über das Leseverhalten bezüglich metro weiß: Die Reihe wird von Leuten gelesen, die, wie die Floskel lautet, »sonst keine Krimis lesen«, und von Leuten, die man als Krimi-Roués oder -Sybariten bezeichnen könnte, also wirklich hartgesottene Freunde des Genres.
Die Kombination heller, lebensfroher Farben auf den Umschlägen mit dem Konzept, keine argen Wörter wie »Massaker«, »Tod«, »Blut«, »Gekröse« und »explodierende Schädel« als Titel zu wählen, funktionierte. Heinz Unternährers Design hat zudem noch den Vorteil, dass die Rücken – also der Teil des Buches, auf den man im Laden sieht – wie ein Leuchtturm leuchten.
Auch als UT metro dann zu metro wurde, d. h. als zunehmend metro-Hardcover entstanden (also seit 2001, als das Kalkül aufkam, die Reihe wieder im UV aufgehen zu lassen, wofür metro da aber schon zu groß, zu berühmt und zu eigenständig geworden war), hielt sich die alte Bezeichnung bei vielen.
Die Taschenbuchsignatur blieb die dominierende Optik, die metro-Hardcover sahen weiter aus wie UV-non-metro-Hardcover. Das bestärkte einerseits den integrativen Aspekt, hatte aber den Effekt, dass sogar einmal ein Non-metro-Hardcover harsche Rezensionen als misslungener Kriminalroman einstecken musste, obwohl es doch gar keiner sein wollte. Die hübsche Ironie eines Imagetransfers …
So waren also die Felder Menge und Optik definiert. Fehlten nur noch die Autorinnen und Autoren. Das Konzept war klar: aktuelle Kriminalliteratur aus aller Welt, geschrieben von möglichst ortsansässigen, bzw. autochthonen bzw. quasi-autochthonen Autoren. Ein Beispiel dafür, gleich in der ersten Staffel, war der Kanadier Christopher G. Moore, der Romane schreibt, die in Bangkok und in umliegenden Ländern (Kambodscha) spielen. Moore lebt in Thailand, spricht Thai, lebt Thai. Er gehört also nicht zu den Autoren, die Romane in möglichst exotischen Weltgegenden ansiedeln, die sie selbst kaum oder nur oberflächlich kennen. Eine Minimalanforderung für metro.
Der globale Aspekt war dabei genauso wichtig wie das literarisch Außergewöhnliche, nennen wir’s mal out of formula: Da waren Helen Zahavi, Walter Mosley, Jerry Raine, William Marshall oder Jerome Charyn und ihre kaum rasterbaren Romane nahe liegend – und sie waren sozusagen das Verbindungsstück zwischen dem Kritiker und dem Herausgeber in mir. Zwischen Neigung und Notwendigkeit. Und der Beweis, dass man auf beiden Seiten des Zaunes mit der »reinen Lehre« nicht weit kommt.
Einer der metro-notorischsten Autoren stammt aus diesem Segment: Jean-Claude Izzo, mit seiner Marseille-Trilogie. Der einzige Autor übrigens, dessen Rechte zu bekommen mir Schweißtropfen auf die Stirn getrieben hatte. Denn lange Jahre bevor ich mit der Planung für metro begonnen hatte, war allgemein bekannt, dass er einer der wichtigsten Autoren des Genres überhaupt war, und ein Riesenerfolg in Frankreich sowieso. Dass er noch zu haben war, d. h., dass sich niemand im deutschsprachigen Raum getraut hatte, ihn zu verlegen, das war zugegebenermaßen mein Glück.
Eine dritte Programmsäule wurde auch gleich am Anfang implantiert: Relaunches wichtiger Klassiker des Genres, die entweder gar nicht mehr greifbar waren oder nur in schauderhaften Ausgaben. An erster Stelle natürlich Chester Himes, mit dem der UV schon vor metro begonnen hatte. Brian Lecomber stand für dieses Prinzip in der ersten Staffel, in späteren Phasen kamen dann Kracher wie Peter O’Donnells Modesty-Blaise-Romane und H.R.F. Keatings Inspector-Ghote-Mysteries hinzu.
Und ein vierte Schiene wurde vorsichtig eingebaut, als sich allmählich zeigte, dass das Gesamtkonzept aufgehen würde: Kriminalliteratur aus Lateinamerika. Da gab es nahe liegende Autoren und Trouvaillen gleichermaßen. Dass Leonardo Padura zu metro stoßen würde, war beinahe naturgesetzlieh notwendig, schließlich kannte ich ihn seit den späten 80er-Jahren, als wir uns hin und wieder in Spanien und Frankreich über den Weg liefen. Diese alte Verbindung wurde umso nützlicher, als es darum ging, Padura trotz eines höheren Angebots der Konkurrenz vertraglich an metro bzw. den UV zu binden.
Während andere alte Verbindungen weniger nützten. So konnten meine mexikanischen Informanten so gar nichts mit dem Namen Guillermo Arriaga anfangen (oder wollten sie nicht können?), genauso wenig wie ich, als ich ein kleines, zerknistertes mexikanisches Taschenbuch in einem Agentur-Paket mit US-Routinekram fand. Das kleine, schmuddelige Taschenbuch war der grandiose Roman »Der süße Duft des Todes« (und das erste metro-Hardcover), Arriaga wurde wenig später für sein Drehbuch zu »Amores Perros« für den Oscar nominiert, der Rest ist Geschichte.
Festzuhalten bleibt, dass es anscheinend Autoren gab, auf deren Bücher sozusagen schon metro draufstand, bevor sie geschrieben waren. Auf den Jazz-Mystery-Romanen von Bill Moody zum Beispiel, auf Garry Dishers Cop-Novels aus Australien, auf Pablo de Santis’ vertrackten Borges-goes-gothic-goes-crime-goes-comic-Romanen aus Argentinien, Raúl Argemís faszinierenden, knallharten Geschichten aus demselben Land, auf Hannelore Cayres hochkomischen, schnellen, schlanken Büchern über den Winkeladvokaten Leibowitz und auf Lena Blaudez’ ironischen und gewalttätigen Polit-Thrillern aus Westafrika, die so ganz den deutschen »Erwartungshorizont« verstörten.
Hin und wieder gab es auch Bücher, die bei allem Kalkül, bei aller Planung und bei aller Strategie nicht voraussehbar waren – au contraire. Als Nury Vittachis erste Sammlung mit dem Fengshui-Detective, mit Meister Wong und seinem nervigen Assistenz-Girlie, auf meinem Schreibtisch landete, schnaubte ich empört. New-Age-Fidelwipp jetzt auch mit Mord, schlimm! Nach drei Minuten Lesen hatte ich aber dann schon fünfmal gelacht, das gab zu denken … Und so wurde Nury Vittachi zu einer Säule von metro – intelligent, witzig, unterhaltend und ganz und gar ohne bebende Ambition. Wesentlichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte hatte und hat Ursula Ballin, die mit ihren wunderbar kreativen Übersetzungen den Fengshui-Detective zu dem gemacht hat, was er heute ist: ein Publikumsliebling und -magnet, der ohne Probleme 500-Leute-Auditorien zum Toben bringt.
Womit wir bei einem weiteren wichtigen Kalkül von metro angekommen wären: die Rolle der Übersetzungen. Die ist essenziell. Deswegen bin ich stolz auf die Garde von feinsten Übersetzerinnen und Übersetzern, die für das metro-Profil wesentlich waren. Und weil sie den ganz persönlichen Sound ihrer Autorinnen und Autoren definiert haben: Hans Joachim Hartstein für Leonardo Padura, Anke Caroline Burger u. a. für Bill Moody und für William Marshall (dafür gab’s den Wieland-Preis), Pieke Biermann für Walter Mosley und Liza Cody (vergleichen Sie mal bitte den Absturz bei Büchern der beiden, die von irgendwelchen anderen Leuten übersetzt wurden), Stefan Linster für u. a. Mongo Beti und Hannelore Cayre, Susanna Mende für Arriaga, Jorge Franco und Raúl Argemí, Peter Torberg für Garry Disher, Gisbert Haefs, dann Claudia Wuttke für Pablo de Santis – um nur einige Namen zu nennen, was mir bitte alle anderen verzeihen mögen, die hier ungenannt, aber nicht weniger geschätzt bleiben … Der Stellenwert der Übersetzung wurde im Featuren der Übersetzer im Anhang sichtbar und führte zur Idee, im Internet, auf der Homepage des Verlages, ein Übersetzerforum mit Diskussionsplatz zu bauen, was später im Getriebe des Alltags leider nicht mehr weiterverfolgt wurde.
Ohne Abstriche allerdings blieb das Konzept der Anhänge. Jedes Buch sollte einen Mehrwert bieten, zusätzliche, nicht werbliche Informationen zu den Kontexten und den Autoren. Also z. B. Discographien der in der Marseille-Trilogie von Izzo erwähnten Musik; Interviews mit den Autoren, die man auf dem deutschen Markt zum ersten Mal antreffen konnte; Essays, die die Bücher in die Kontexte einordnen, in die sie gehören; Aussagen und Reflexionen der Autoren selbst; Informationen zu politischen und kriminologischen Fakten, zu Wirtschaft und Geographie, wenn nötig. Jede Menge weiterführendes Material also, Filmo- und Biographien, Links.
Denn Kriminalromane, auch das gehört zum metro-Konzept, wollen und sollen kommunikativ sein – als Literatur Teil des sozialen Prozesses. Keine monolithischen Blöcke, die einsam in der l’art-pour-l’art-Landschaft herumstehen. Die Kontextualisierung der einzelnen Bände konnte das zeigen.
Die Resonanz des Publikums auf diese grundsätzliche Ausstattung der Bücher war hervorragend. Dass inzwischen viele Verlage auch ihre Übersetzer ein wenig hervorheben, darf sich metro als Pilot zugutehalten.
Die üblichen schrillen Töne der Sauertöpfe – Interessiert mich doch nicht, wer der Autor ist! Ich lass mir doch nicht vorschreiben, wie ich das Buch lesen soll! Warum soll ich für so’n Mist noch zahlen, mach doch lieber das Buch billiger! – passen, recht besehen, zu der Schere zwischen einem Publikum, das sich widerstandslos mit allem, was »barrierefrei« funktioniert, bespaßen lassen möchte und einem qualifizierten Publikum, für das zu arbeiten großes Vergnügen bereitet und sich lohnt. Der »Erwartungshorizont«, von dem oben die Rede war, ist an dieser Stelle wichtig – der Einsatz der Mittel und Möglichkeiten bewahrt vor falscher Bescheidenheit und bratzender Megalomanie gleichermaßen. Die Erkenntnis, dass die Nische, die dieses Publikum bildet, dennoch so groß ist, dass ein Programm wie metro dauerhaft ökonomisch erfolgreich sein kann, sind die Good News nach zehn Lebensjahren, von denen dann – so gesehen – kein einziges verschwendet war.
Metro gibt es auch ohne mich, so lange noch Autoren beim UV unter Vertrag sind, die aus meiner »Werkstatt« kommen. Claudia Piñiero aus Argentinien, ihr Landsmann Raúl Argemí, der galizische Newcomer Domingo Villar und die Schwestern Tran Nhut aus Vietnam. Nebst noch weiteren Büchern von Garry Disher, Hannelore Cayre und Pablo de Santis und anderen, soweit sie eingekauft sind.
Den Rest regelt dann, wie üblich, der Markt.