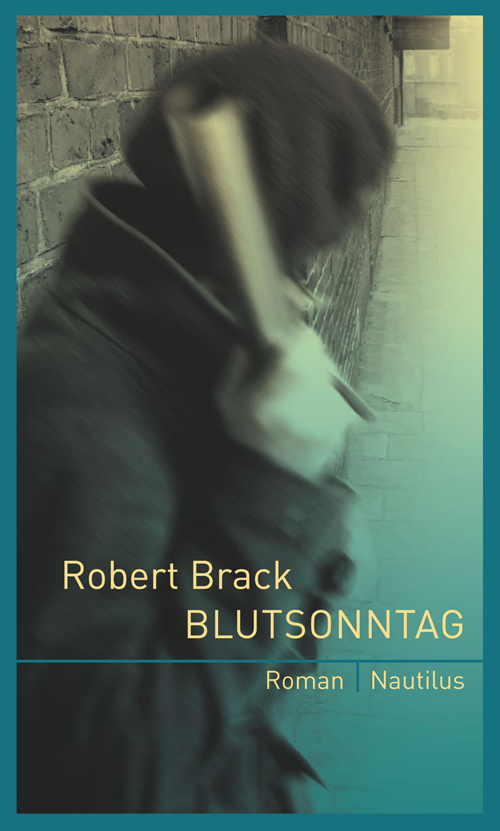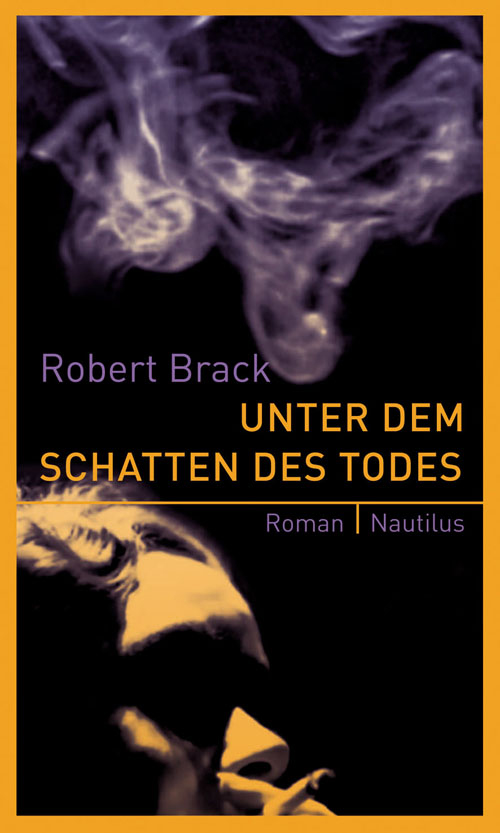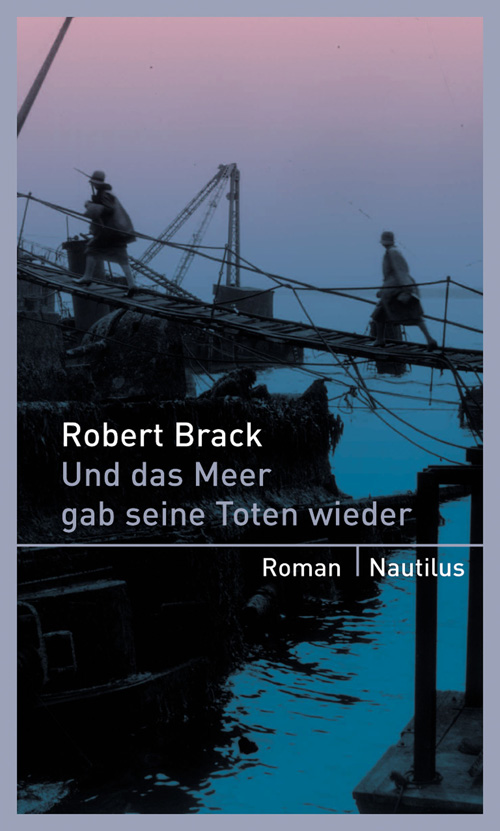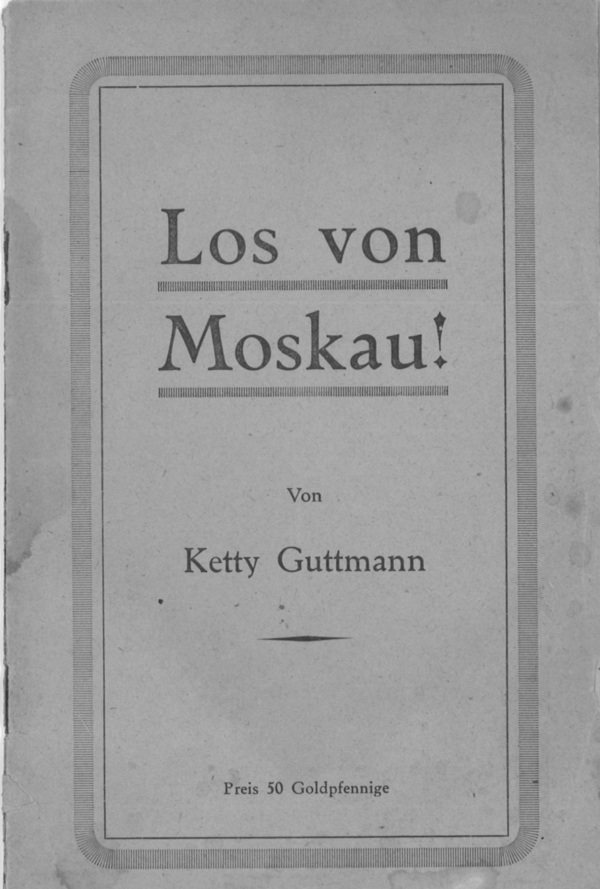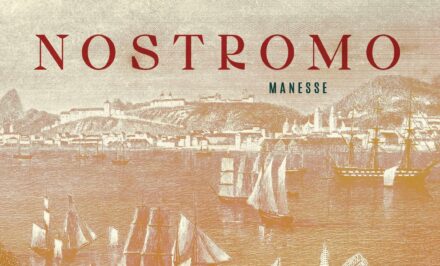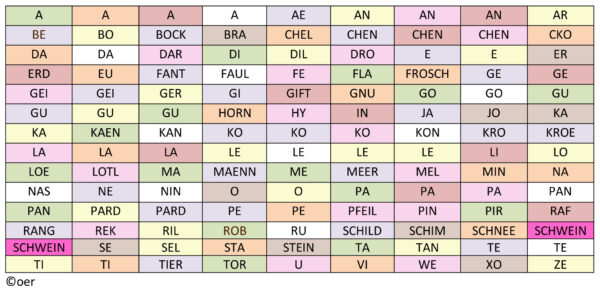Kurzbesprechungen von Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Lutz Göllner (LuG), Alf Mayer (AM) und Tobias Gohlis (TG) zu:
Zoë Beck: Memoria
Daniel Borgeldt: Cheyenne
Robert Brack: Schwarzer Oktober
Elisabeth Bronfen: Händler der Geheimnisse
Jesús Cañadas: Am Anfang ist der Tod
Patrick Deville: Fenua
Heike Monogatari. Der Sturz des Hauses Taira
Stephen King: Holly
Joe R. Lansdale: Things Get Ugly. The Best Crime Stories
Ernst S. Steffen: Wenn ich nach Hause komme. Gedichte und Prosa aus dem Gefängnis
Benjamin Stevenson: Die mörderischen Cunninghams

Rache ist Blutwurst
(LuG) Der Blick von außen tut manchmal sehr gut: Jesús Cañadas ist ein Genreautor aus Spanien, hauptsächlich in den Bereichen Fantasy und Horror tätig, der seit 14 Jahren in Berlin lebt. Hier spielt auch sein neuester Roman Am Anfang ist der Tod, der erste, der auf Deutsch erscheint. Und der lässt sich – sehr deutsch! – erstmal fast wie ein „Tatort“ an: Lukas ist ein junger, polnisch-stämmiger Kommissar, der in Neukölln lebt und in einer Erdgeschosswohnung auf einem düstern Hinterhof seinen sterbenden Vater pflegt. Sein neuester Fall: Er soll die Schülerin Rebecca finden, die ganz bei ihm in der Nähe auf ein katholisches Internat ging, und die irgendwo im unübersichtlichen Berliner Nachtleben verloren ging. Dabei wird ihm der ältere Kollege Ritter zur Seite gestellt, ein Polizist mit – nun ja, sagen wir es freundlich – eher traditionellen Ermittlungsmethoden; Dirty Harry war im Gegensatz zu Ritter ein feinfühliger Liberaler. Besonders Migranten bekommen das immer mal wieder zu spüren.
Allerdings gibt es von Anfang an Disruptionen, wie sie in einem Deutschländer-Krimi nicht möglich wären. Bei ihren Recherchen in der Clubszene stoßen die beiden Polizisten auf einen Alptraum aus Sex und Gewalt, auf den geheimnisumwitterten Herrscher über die Berliner Unterwelt, den Hörnerkönig. Und dann taucht Rebecca wieder auf, transformiert zu einem gnadenlosen Racheengel.
Cañadas kennt die Stadt gut. Die Schauplätze in Neukölln kann man mit seinem Roman in der Hand ablaufen und wird keinen Fehler finden. Das Elend, das sich in den letzten Jahren rund um die U-Bahnhöfe Hermannplatz und Neukölln, in der Gegend um den schönen, alten Körnerpark und den ehemaligen St.-Thomas-Friedhof II breit gemacht hat, beschreibt der Spanier nicht pittoresk, sondern überaus realistisch. Der Club „Das Loch“ und die geheimnisvolle Raucherzone sind dem Berghain und seinem Lab.Oratory nachempfunden. Das ehemalige Quelle-Kaufhaus, das zwischenzeitlich – wie im Roman – eine Flüchtlingsunterkunft war, und das katholische Internat kennt jeder Neuköllner.
Es sind diese Anker im Realismus, die Cañadas immer wieder dazu benutzt, nicht ins Esoterische abzugleiten. Hier kann man seinen Roman durchaus mit den Krimis des Horrormeisters Stephen King vergleichen: Nicht übermächtige Kräfte sind für das Böse verantwortlich, sondern einzig und allein der Mensch selber. Und so ganz nebenbei ist dieses Buch auch ein großartiger Roman über feministische Selbstermächtigung. Allerdings ist der Horror, der nach 200 Seiten mit aller Macht über die Leser hereinbricht, absolut nichts für Schneeflöckchen.
Jesús Cañadas: Am Anfang ist der Tod (Dientes Rojos, 2021). Aus dem Spanischen von Verena Kilchling. Suhrkamp Verlag, Edition TW, Berlin 2023. 440 Seiten, Klappenbroschur, 17 Euro.

Viel Verbrecherkino und Spannung
(JF) Die Sozialarbeiterin schenkt ihr Salingers „Der Fänger im Roggen“. Das Buch habe sie als Teenager „richtig super“ gefunden. Aber die 18-jährige Cheyenne Boudica kann dem Klassiker der Adoleszenzliteratur wenig abgewinnen. „Es ging um reiche Muttersöhnchen an einer Schule für reiche Muttersöhnchen.“ Gut geschrieben allerdings sei der Roman, das gibt sie zu. Und dies ist vielleicht der Grund dafür, warum sie ihre Geschichte ein bisschen im Stil von Holden Caulfield erzählt. Rotzig und geradeheraus. Aber hier enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Denn Cheyennes Vater war natürlich kein reicher Anwalt, sondern Gelegenheitsarbeiter mit einem schweren Alkoholproblem.
Doch das ist Vergangenheit. Jetzt ist sie Vollwaise, lebt mit ihrem Bruder Troy, einem antriebsschwachen Kleindealer, zusammen und arbeitet in einem Geschäft für Billigtextilien. Geborgen fühlt sie sich in der Pizzeria ihrer Großmutter, die einst aus Albanien eingewandert ist. Dass die geliebte Oma, für ihre Enkelin „die coolste Frau“, der sie je begegnet ist, nicht nur vom Pizzaverkauf lebt, ist bald klar. Schließlich befinden wir uns in einem handfesten, streckenweise ziemlich blutigen Gangsterroman und nicht in einem Sozio-Drama. Zumindest sieht es so aus. Denn anders würde es die gewitzte Erzählerin Cheyenne, deren große Passion das Verbrecherkino von Howard Hawks bis Martin Scorsese ist, auch nicht wollen. Und dass nicht immer klar wird, wo eine erinnerte Filmhandlung endet und das Romangeschehen beginnt, ist erkennbare Absicht.
Ausgedacht hat sich all das der 1982 geborene Autor Daniel Borgeldt, dem hier ein ausgeprägtes Talent als erstklassiger Stimmenimitator bescheinigt werden muss. Cheyenne ist nicht nur ein rasant erzählter kleiner Roman von beträchtlicher Spannung, sondern auch eine passionierte Hommage an eine große Filmtradition. Dass darüber die gesellschaftliche Realität nicht vergessen wird, darf man diesem lesenswerten Buch hoch anrechnen.
Daniel Borgeldt: Cheyenne. Ventil Verlag, Mainz 2023. 181 Seiten, Paperback, 16 Euro.
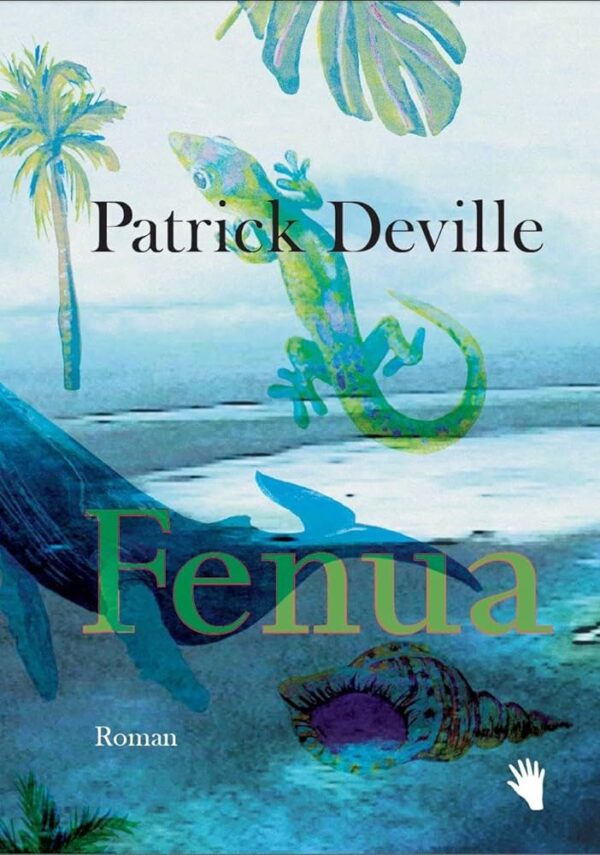
In die Augen sehen, die uns anblicken
(AM) Ein Gecko huscht über das Cover von Fenua, den neuen Roman von Patrick Deville. Das Vorsatzpapier zeigt eine alte Landkarte von Tahiti, hinten am Buchende sind es die Inseln Polynesiens. Das Motto stammt aus Marguerite Yourcenars „Die schwarze Flamme“ und lautet: Wer könnte so verrückt sein und sterben, ohne sich wenigstens in seinem Gefängnis umgesehen zu haben? Das Buch beginnt mit der Kapitelüberschrift „erstes Bild“, das stammt vom 15. August 1865, ist weder Zeichnung, noch Aquarell oder Tafelbild, sondern eine Kalotypie. Ein Blick auf Tahiti. Und es schaut schon gleich zurück, aus den Augen eines Eingeborenen namens Aoturu, der vom Weltreisenden Louis-Antoine de Bourgainvilles 1768 nach Paris gebracht wird, wie auch aus den Augen von Omai, der vielleicht Ma’i hieß und gegen den Willen von Captain Cook an Bord genommen wurde. „Cook sah keinen Nutzen darin, sich mit diesem Mann zu belasten, der seiner Meinung nach kein gut gewähltes Musterexemplar eines Bewohners dieser glücklichen Inseln war, da er weder die Vorteile einer Geburt von Rang noch die eines erworbenen Rangs besaß.“
John Byron, der Großvater des Dichters Lord Byron, kommandiert die Fregatte Dolphin, die 1765 namenlose Atolle im Norden des Tuamoto-Archipels meldet. Es dauert noch drei Jahre, ehe die Boudeuse vor Papeete anlegt. Für die Europäer wird die Insel Tahiti die erste, über die sich die Wissenschaft hermachte, ein großes philosophisches Laboratorium. Das Sehnsuchtsziel eines „Naturzustands“. Südsee, hach. Diderot: „Der Tahitaner steht dem Anfang der Welt, der Europäer ihrem Greisenalter so nahe!“
Aber das ist alles falsch. Und Patrick Deville ist der geeignete Reiseleiter, uns mit seiner Methode des „Romans ohne Fiktion“ das Südseeparadies vom Kopf auf die Füße zu stellen. Nicht nur in ihm zu schwelgen – das dürfen wir genug, sondern auf Roland Barthes zu hören: „Ich habe die Augen gesehen, die mich angeblickt haben.“ Also gleichzeitig zu verschiedenen Zeiten in mehreren Ländern und mit mehreren Sprachen zu leben. Meta-Literatur, Vergangenheit und Gegenwart in einem fast simultanen Gedanken- und Bilder-Komplex. Sinnlich, flirrend, erhellend. Reiseerfahrungen mit gesellschaftlicher Analyse. Von Holger Fock und Sabine Müller vorzüglich übersetzt. Bilger-Bücher machen immer großen Spaß. Zuverlässig.
Wer mit Deville reist, erlebt mal schärfere, mal freundlichere Verhöre mit unserer kolonialen und kulturellen Vergangenheit. „Kernbohrungen“ nennt er seine Bücher: „Ich ziehe an einen Ort, und mein Ziel ist es dann, ihn zu erkunden, sei es Havanna, Montevideo, Phnom Penh.“ Also folgen wir in „Fenua“ dem Arzt Victor Segalen, der den Spuren Gauguins folgt, der wiederum denen Pierre Lotis folgte, während die englischsprachigen Schriftsteller auf den Spuren Stevensons unterwegs waren, der wiederum Melville gefolgt war. Auch Somerset Maugham kam nach Tahiti, schrieb einen Roman über Gauguin. Der Dichter Robert Brooke war da („In der Südsee findet man nur das, was man mitbringt“), der böse Robert James Fletcher mit seinen Briefen, Jack London auf der von ihm selbst entworfenen Yacht Snark, die Filmregisseure Robert E. Flaherty und Friedrich Wilhelm Murnau. Der empfing während seiner eineinhalb Jahre auf Tahiti auch Henri Matisse, Simenon schrieb in Murnaus Villa zwei Romane. „Bananentourist“, so einer der beiden Titel, ist man nach der Lektüre sicher nicht mehr.
Patrick Deville: Fenua (2021). Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Bilgerverlag, Zürich 2023. 400 Seiten, gebunden, mit Lesebändchen, 28 Euro.

Holly Gibney jagt senile Kannibalen
(hpe) Die Altersforschung boomt. Denn immer mehr Menschen wollen immer älter werden. Unsterblich gar. Zu den Therapien, die erforscht werden, gehören etwa Infusionen von Blutplasma von jungen Menschen. Das soll verjüngend wirken. Das ist Fakt, keine Fiktion.
Vor diesem Hintergrund wirkt das betagte Professorenpaar Harris, das in Stephen Kings neuem Roman Holly junge Menschen kidnappt, tötet und isst, um das eigene Leben zu verlängern, eigentlich gar nicht soo wahnsinnig durchgeknallt. Obwohl sie es durchaus sind. Der emeritierte Biologe, der an der Uni Mr. Meat genannt wurde, und die ebenfalls emeritierte Englischprofessorin sind nicht einfach alte Leutchen, die ein bisschen zu weit gegangen sind. Sie sind bösartig und hinterhältig. Und auch rassistisch. Sie vor allem. Er bringt immer weniger auf die Reihe; die Demenz nagt an ihm, da kann er noch so viel junges Hirn schlürfen.
Die private Ermittlerin Holly Gibney, die King 2014 in „Mr. Mercedes“, dem ersten Teil der Bill-Hodges-Trilogie, erstmals auftreten ließ, bekam im neuen Roman die Titelrolle. Auf der Suche nach einer vermissten jungen Frau kommt sie dem geriatrischen Killerpaar auf Umwegen auf die Spur. Vor allem, weil sie nach und nach erkennt, dass in den letzten Jahren in der Gegend andere Menschen verschwunden sind. Und dass es da immer wieder Bezüge zu dem als etwas schrullig geltenden Paar gibt.
Holly hat eben ihre Mutter zu Grabe getragen, mit der sie sich in letzter Zeit zunehmend gezofft hat. Über Trump. Über Corona. Diese Krankheit, die es gar nicht gibt und gegen die die Mutter deshalb auch keine Impfung wollte, hat sie schließlich dahingerafft. Wie so oft zeichnet Stephen King auch ein Bild der Zeit. Es ist, abgesehen von Rückblenden, der Sommer 2021. Die Präsidentschaft von Trump und die Verwerfungen, die sie in der Gesellschaft verursacht hat, wirken nach; die Pandemie lässt Holly und ihre Freunde vorsichtig sein, während andere die Maskenträger und Ellbogengrüßer verspotten. Obwohl es eigentlich wenig zu lachen gibt, prägt entspannter Humor die Erzählweise.
Natürlich macht es Vielschreiber King auch hier nicht unter sechshundert Seiten. Leicht selbstironisch beklagt er sich in einer Nachbemerkung über die Kürzungsvorschläge, die seine Lektorin durchgesetzt habe. Einmal mehr fragt man sich, ob man sich diesen Umfang wirklich antun will. Ist man dann aber einmal in der Geschichte, vergisst man das.. Weil King es versteht, eine Art angenehm prickelnden Sog zu entwickeln, den einen mitzieht.
Stephen King: Holly (Holly, 2023). Aus dem Englischen von Bernhard Kleinschmidt. Heyne Verlag, München 2023. 640 Seiten, 28 Euro.

Auf dem Blechnapf getrommelt
(AM) In den 1970er Jahren galt der Heilbronner Autor Ernst Siegfried Steffen als einer der bekanntesten deutschen „Gefängnisschriftsteller“, auch wenn er die Bezeichnung selbst immer vehement ablehnte. Sein Werk ist schmal: neben dem Gedichtband „Lebenslänglich auf Raten“ (1969) noch die 1971 posthum erschienene „Rattenjagd. Aufzeichnungen aus dem Zuchthaus“. Schon vor Jahren fand der Tübinger Verleger Hubert Klöpfer: „Dieser Dichter, seine Geschichte, seine Gedichte dürfen nicht untergehen, sie sind – gewitzt, reflektiert, sarkastisch, verletzt – gleichsam die literarische Gegenwehr eines Verbrechers aus verlorener Kindheit und Jugend… ein später Verwandter Francois Villons?“
Anton Knittel hat nun in der Edition Klöpfer eine erweiterte Ausgabe der Gedichte und einiger Prosastücke unter dem Titel Wenn ich nach Hause komme neu herausgegeben. Auszüge daraus finden Sie bei dieses Mal bei unserem monatlichen Krimigedicht. Tatsächlich haben Steffens Worte nichts von ihrer lyrischen Kraft verloren. Zeitlebens ein Unbehauster, so Knittel, war Steffens mehr Opfer des Systems als gemeingefährlicher Täter. Sein alkoholabhängiger Vater zertrümmerte ihm im Alter von zwölf Jahren das Gesicht, aus der Heimkarriere wurde eine unglücklich verkettete Odyssee durch Erziehungsanstalten und Gefängnisse, aus Bagatellen wurden Verwahrungen und letztlich Zuchthaus.
In der Strafanstalt Bruchsal entdeckte der junge Gefängnisassessor Rolf Zelter, Vater des Schriftstellers Joachim Zelter, das Schreibtalent des Häftlings. Im Stuttgarter Theater der Altstadt las Zelter im Januar 1967 dann „unveröffentlichte Lyrik und Prosa von Strafgefangenen“. Den Flyer zur Lesung unter dem Titel „Auf dem Blechnapf getrommelt“ entwarf Steffen selbst, er arbeitete damals in der Druckerei der Strafanstalt. Insgesamt saß er mehr als die Hälfte seines Lebens hinter Gittern. Jedes Wort bei ihm ist einer unfreundlichen Welt abgetrotzt.
Ernst S. Steffen: Wenn ich nach Hause komme. Gedichte und Prosa aus dem Gefängnis. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Anton Knittel. KrönerEditionKlöpfer, Stuttgart 2023. 120 Seiten, Hardcover, Lesebändchen, 20 Euro.
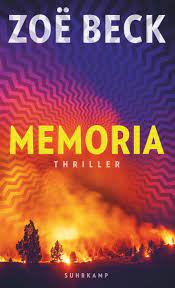
Raffinierter Plot, viele Schichten
(TG) Zoë Beck erforscht gerne Zukünftiges. Nach der Dystopie „Paradise City“ von 2020 über eine weit in der Zukunft liegende Gesundheitsdiktatur spielt Memoria im nahen Futur, das grauslich genug ist. Die Klimakatastrophe ist verschärft, die soziale Katastrophe ist auf dem Fuße gefolgt. Beides als Hintergrund mit wenigen anschaulichen Strichen skizziert. Bei der Rettung einer alten Frau, die sich alleine nicht aus ihrem Hochsicherheitshaus vor dem drohenden Waldbrand befreien kann, tut Harriet Erstaunliches. Obwohl sie keinen Führerschein hat und auch nicht fahren kann, übernimmt sie das Steuer eines rettenden Fahrzeugs und kutschiert die alte Dame aus der Feuerzone. Bei der Neuausstellung ihrer verbrannten Papiere erhält sie auch einen Führerschein.
Bald mehren sich Hinweise, Gedankenfetzen drängen sich auf, dass Harriet nicht immer unter prekären Verhältnissen Klavierbauerin und Securitykraft in einem Luxuskaufhaus war. Sie macht sich von Frankfurt aus auf nach München, wo sie ihr Elternhaus, das vorgeblich verkauft wurde, unversehrt vorfindet, hilfsbereite Nachbarn und sogar ein Vermögen, das sie verschwunden glaubte. Die alte Umgebung und neue Bekannte helfen ihr, verschüttete Erinnerungen zu aktivieren. Zoë Beck greift dabei auf einen persönlichen Erfahrungsschatz zu. Wie ihre Protagonistin Harriet war sie eine talentierte Pianistin, gab bereits als Kind Konzerte, musste dann als Folge einer teilweise misslungenen Handoperation die professionelle Karriere aufgeben. „Memoria ist keine Autofiction“, betont sie.
Welches Schicksal Harriet vom Klavier und beinahe aus dem Leben katapultiert, hat Zoë Beck in den Zwiebelschalen eines raffinierten Plots verpackt, der mit Gedächtnisraub, familiärer und toxischer männlicher Gewalt gespickt ist.
Zoë Beck: Memoria. Suhrkamp Verlag, Berlin 2023. Klappenbroschur, 282 Seiten, 16,95 Euro.

Die elfte Krimi-Regel
(JF) Den berühmt-berüchtigten zehn Regeln für das Verfassen von Detektivromanen, die der schriftstellernde Pfarrer Ronald Knox 1929 aufstellte, hätte eine elfte, das Verbot von Geheimorganisationen betreffend, gut angestanden. Aber wahrscheinlich dachten die Mitglieder des Detection Clubs, für die er seinen Dekalog formulierte, es genüge, Chinesen aus der Geschichte zu verbannen. Eine Formulierung, die heute zu Recht als rassistisch gilt, obwohl die Regel nur dazu anhalten sollte, Stereotype und Klischees zu vermeiden.
Der australische Autor und Comedian Benjamin Stevenson jedenfalls, dem mit seinem Kriminalroman Die mörderischen Cunninghams eine gewitzte Hommage an die Detektivliteratur des so genannten „Goldenen Zeitalters“ gelungen ist, zitiert Knox deshalb nur unvollständig, nennt aber den Grund für seine Auslassung: „Hier wurden unsensible historische Begriffe gestrichen.“ Dass er dafür eine kriminelle Geheimorganisation ihr Unwesen treiben lässt, könnte man also als Griff in die Klischeekiste tadeln, aber das wäre angesichts eines Romans, der sich auch sonst großzügig im Genrefundus bedient, natürlich albern. Schließlich verfügt Ernest Cunningham, Erzähler und auch wesentlicher Protagonist der Mordgeschichte, als Autor von Anleitungen zum Krimischreiben über die notwendige Expertise und wird nicht müde, die Wiedergabe der Handlung mit launigen handwerklichen Hinweisen zu garnieren.
Das ist sehr amüsant und auch rechtschaffen spannend. Wer Australien als Tatort bislang nur von seiner sonnenverbrannten Seite kennengelernt hat, wird sich über ein verschneites Skiresort, wo die dysfunktionale Familie Cunningham samt Anhang zu einem unharmonischen Treffen zusammenkommt, freuen. Die erste Leiche, offenbar keinem der Anwesenden bekannt, lässt nicht lange auf sich warten. Ein Mörder geht um, doch wer ist es? Man kennt die Frage und, wen sollte es wundern, in gewissem Sinne auch die Antwort. Schließlich erzählt Benjamin angeblich streng nach den Regeln des Detection Clubs, und die gelten für einen „fairen Kriminalroman“ ohne Tricks und doppelten Boden. Dafür spielt ein leistungsstarkes Vergrößerungsglas eine entscheidende Rolle. Am Ende sind gleich mehrere Rätsel aus der Familiengeschichte der Cunninghams gelöst und die Täterfrage gleich mit. Was will man mehr?
Benjamin Stevenson: Die mörderischen Cunninghams. Irgendwen haben wir alle auf dem Gewissen (Everyone in my family has killed someone, 2022). Aus dem Englischen von Robert Brack. List Verlag, Berlin 2023. 380 Seiten, 16,99 Euro.
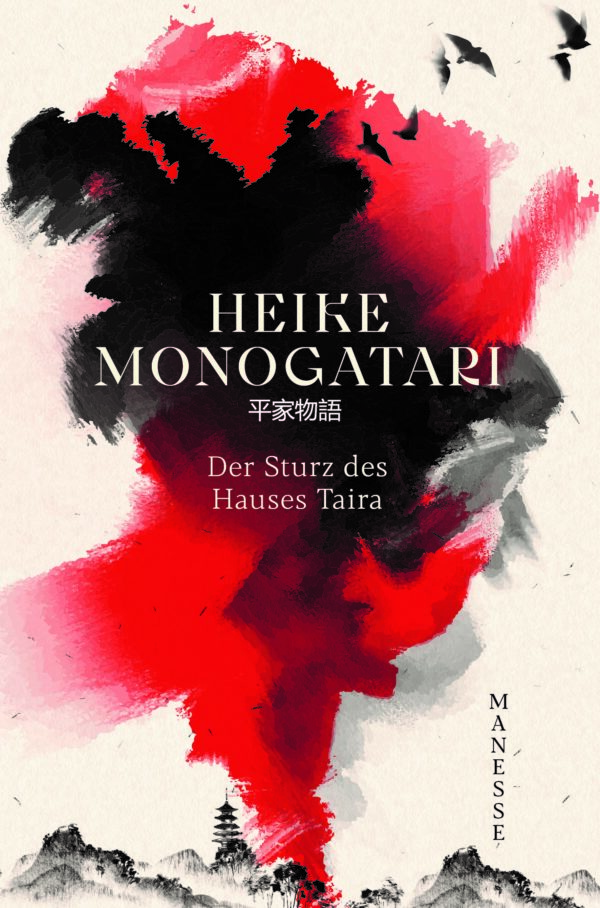
Die stärksten Helden werden fallen
(AM) Wie Homers „Ilias“ wurde das japanische Epos Heike Monogatari (zu übersetzen als „Erzählungen vom Hause Taira“) erst über Jahrhunderte in gesungener Form weitergegeben. Anonym tradiert, handelte es sich dabei um ein Gemeinschaftswerk fernöstlicher Mönchskultur, vorgetragen von blinden Sängern, den sogenannten Biwa Hōshi, von einer Laute (biwa) begleitet. Im 12. Jahrhundert gedichtet, schriftlich fixiert um 1370, blieb der epochale historische Roman sieben Jahrhunderte lang im Deutschen unübersetzt. 2022 gab es bei Reclam eine von Björn Adelmeier übersetzte Ausgabe. Jetzt ist das Werk bei Manesse in einer Neuübersetzung von Michael Stein (der bereits Sei Shonagons „Kopfkissenbuch“ ins Deutsche brachte und dafür viel Lob erntete) als bibliophile Prachtausgabe erschienen – umfassend kommentiert und fachkundig erläutert, feinstens ausgestattet, äußerst lesefreundlich gestaltet und organisiert, das Papier eine haptische Schmeichelei. Druck und Fadenheftung bei Pustet, Regensburg.
Die Saga erzählt in zwölf Büchern (und einem geheimen) vom epochalen Umbruch von der aristokratischen zur feudalen Gesellschaft Japans. In seiner Wucht wird das Werk dem Nibelungenlied gleichgestellt; es ist der erste und gleich schon bedeutendste Vertreter des Genres der Gunkimono (Samuarai-Literatur), „das mit Abstand ausgewogenste, literarisch wertvollste und sprachlich schönste aller Werke dieses Genres“, betont Übersetzer Michael Stein in seinem Nachwort. Es gibt erzählerische Passagen, Dialoge, Briefe, Gebetstexte und Gedichte., mitreissende Passagen, Luft und Raum und Himmel. Mehrfarbiger Druck, rote Paginierung, Fußnoten an Ort und Stelle, klare Erläuterungen, zwei Lesebändchen, dazu eine unpathetische Übersetzung, bergbachklare Sprache, ein kluger Registerapparat und schöne Gestaltung (Anne Schmidt) helfen, die Lektüre unangestrengt zu machen.
Es fließt reichlich Blut, keiner einzigen Frau aber wird ein Haar gekrümmt. Die Leiden der Zivilbevölkerung – man muss in diesen Gaza-Tagen unweigerlich daran denken – haben Raum und erzählerische Gestalt. In der Form eines historischen Romans geht es um die von grausamen Kämpfen begleitete Machtergreifung durch den Samarai-Stand: „Seit alter Zeit bis in unsere Tage standen die beiden Adelshäuser Minamoto und Taira in Diensten des Kaiserhofes, und wenn das eine Haus sich kaiserlicher Autorität widersetzte oder sie gar ins Wanken brachte, war das andere zur Stelle, um es zur Rechenschaft zu ziehen, sodass der Friede im Reich nicht in Gefahr geriet. Nachdem jedoch…“
Dennoch ist dies weit mehr als eine Krieger-Sage, kein reines Heldenepos, sondern ein Gesellschaftspanorma aus Sicht gebildeter buddhistischer Geistlicher: Was in Blüte steht, muss vergehen, der Mächtige kommt zu Fall, auf Hochmut und Frevel folgt zuverlässig Untergang. Mehr als tausend Personen werden im Text genannt, bis heute sind sie und das Epos Stoff zahlloser Serien im Staatsfernsehen, längst auch von Manga-Serien. Den Japan-Kenner Donald Ritchie inspirierte der bärbeißige Krieger Kumagi zu seinem historischen Roman „The Memoirs of Warrior Kumagai“. Laficadio Hearn machte die blinden Biwa Hōshi zu Erzählern in „Kwaidan – Stories and Studies of Strange Things“ (Japans Geister; Die Andere Bibliothek, Band 372).
Nun aber nicht zu viel Respekt und Schwelle vor dem Einstieg in dieses sehr lesefreundliche arrangierte Buch. Auf zur Tempelglocke von Gion:
„Die stärksten Helden
werden am Ende doch fallen,
verwehen wie Staub vor dem Windhauch.“
Heike Monogatari. Der Sturz des Hauses Taira (Heike Monogatari). Aus dem Japanischen und mit einem Nachwort von Michael Stein. Mit Land- und Palastkarten, Glossar, Literatur- und Personenverzeichnis, Chronologie und Ahnentafeln der japanischen Kaiser, des Hauses Taira und des Hauses Minamoto. Manesse Verlag, München 2023. Hardcover, Leinen, 896 Seiten, 4 farbige Abbildungen, 70 Euro.
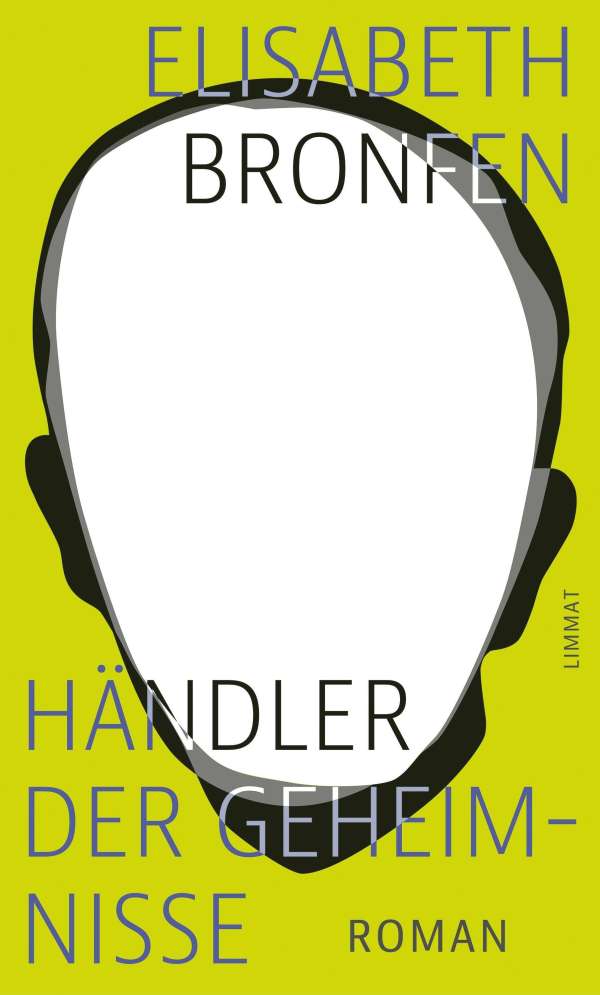
Vielleicht ist es ja Absicht
(JF) Als der Rechtsanwalt George Bromfield 1995 als 72-Jähriger an den Folgen eines Schlaganfalls stirbt, fällt ein begründeter Verdacht auf seine zweite Ehefrau. Hatte sie beim Ableben des alten Herrn ihre Hand im Spiel? Zwei von Bromfields Kindern aus erster Ehe, die in München lebende Literaturwissenschaftlerin Eva und der Jurist Max, der wie sein Vater in New York lebt, stellen Nachforschungen an. Auch die Polizei wird eingeschaltet. Und Detective Damon Faye, ein Veteran des Koreakriegs kurz vor der Pensionierung, verbeißt sich regelrecht in den Fall. Denn nicht nur Bromfields Tod ist seltsam, auch seine Biografie wirft Fragen auf. Warum ist er, der gegen Kriegsende in Deutschland stationiert, war, einige Jahre später wieder nach Bayern zurückgekehrt, um dort als Anwalt zu praktizieren? Als Jude in das Land der Mörder, wo man gerne über die Zeit des NS-Regimes schweigt.
Die Anglistin Elisabeth Bronfen erzählt in ihrem Romandebüt Händler der Geheimnisse eine Geschichte, die deutliche Parallelen zu ihrer eigenen Familienbiografie aufweist. Selbst der Name Bromfield ist wohl mit Bedacht gewählt. Dass mit Eva eine ausgewiesene Shakespeare-Expertin im Mittelpunkt steht, passt auch gut. Zumal das Werk des großen Dramatikers einen wunderbaren Spiegel für die Romanhandlung, in der der Täuschungen und Geheimnisse eine zentrale Rolle spielen, abgibt.
„Händler der Geheimnisse“ ist ein intellektuell anregender, aber literarisch eher unbefriedigender Roman. Zu betulich der Stil, zu papiern die Dialoge. Aber vielleicht war diese Künstlichkeit auch ästhetische Absicht, zeigt doch ausgerechnet der Epilog, in dem eine zentrale Begebenheit aus dem Leben des Verstorbenen packend geschildert wird, dass Bronfen auch anders kann. Wenn sie denn gewollt hätte.
Elisabeth Bronfen: Händler der Geheimnisse. Limmat Verlag, Zürich 2023. 314 Seiten. 28 Euro.
Revolver neben dem Tintenfass
(AM) Immer ein Mehrwert, mögen die Bände auch schmal sein, die Sprache knapp, die Erzählhaltung lakonisch wie bei Simenon, elegisch wie bei den Existentialisten – das sind die historischen Kriminalromane um Klara Schindler des Hamburgers Robert Brack, der seinen Manchette, Noir, Neo-Noir und Polar kennt (Texte dazu von ihm bei uns hier und hier). Position Anschlag Tastatur: „Abend für Abend rekonstruiere ich meine Erinnerungen, schreibe neu, was mir gestohlen wurde. Individuelle Wiederaneignung. Der Revolver liegt neben dem Tintenfass“, heißt es in Schwarzer Oktober. Ein Dialog dort: „Wo willst du hin?“ – „In den Kommunismus.“
Zum Menschsein gehört die Arbeit, zum Proletsein die Fabrik. Hamburg ist rot, die Vulkanwerft besetzt. Die Hochseefischer streiken immer noch. Räterepublik. Aufstand der Barmbecker Kommunisten. Nur eine Arbeiter- und Bauernregierung kann Deutschland noch retten. Mitten drin die Ladendiebin und Gelegenheitsarbeiterin Klara Schindler. Sie liest Ketty Guttmann im „Pranger“, sucht auf eigene Faust den „Schnitter“, der in Hamburg umgeht und „Kontrollmädchen“ absticht. Robert Brack war mit Klara schon 1931, 1932 und 1933 unterwegs, in „Und das Meer gab seine Toten wieder“ (2008), „Blutsonntag“ (2010) und „Unter dem Schatten des Todes“ (2012). Jetzt erleben wir sie und die radikale Feministin und Kommunistin Ketty Guttmann im Jahr 1923, Juli bis November. Polizeigeschichte anders. Frauen- und Proletensicht. Wir sollten nicht wieder zehn Jahre warten müssen.
Robert Brack: Schwarzer Oktober. Edition Nautilus, Hamburg 2023. Broschur, 160 Seiten, 16 Euro.
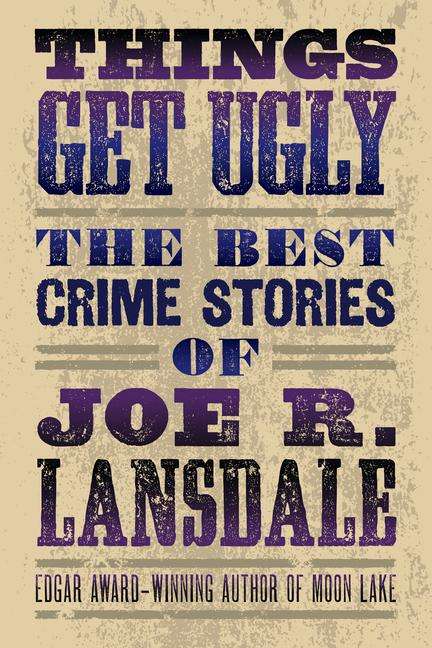
Bohnen, Kekse, Bier – und ein Cheers!
(AM) Jetzt am 28. Oktober ist er 72 geworden, lebt in Nacogdoches, East Texas. An die 50 Romane – sei es Crime, Western, Horror, History, Fantasy, Science Fiction, Weird oder Comics, seine Website hier –, dazu an die 400 Kurzgeschichten und Novellen, eine Handvoll Drehbücher und die Selbstverteidigungs-Technik Shen Chuan Martial Science gehen auf sein Konto. Nur wenige zeitgenössische Autoren sind so produktiv wie er. Zu Triggerwarnungen meint er: „If you’re of a sensitive nature, my work is not for you in any area. I’m proud of that.“ Die Autorin Christa Faust nennt ihn „a national fucking treasure“, findet ihn „pulpy, blackly humorous, compulsively readable, and somehow both wildly surreal and down-to-earth“. Lavie Tidhar, Autor von „Maror“ (2024 bei Suhrkamp in der TW Edition) sieht ihn als den „geistigen Erben sowohl von Walt Whitman wie von Elmore Leonard“. Genug der Salute.
Zusammen mit Herausgeber Richard Klaw hat Joe für Things Get Ugly. The Best Crime Stories of Joe R. Lansdale 19 seiner Kurzgeschichten aus den Jahren 1993 bis 2016 herausgesucht, etliche von ihnen in Anthologien verschüttet, die heute nur noch schwer zugänglich oder unerschwinglich teuer geworden sind. Etwa „Outsiders: 22 All New Stories from the Edge“ von 2005, für die Joe „The Shadows, Kith and Kin“ beisteuerte, einen Versuch, in die Haut von Charles Whitman zu schlüpfen, der 1966 in Austin, Texas, als 25jähriger Architekturstudent mit einem Gewehr auf den Turm der Universität stieg und zu einem der ersten medial begleiteten Amokläufer der Nachkriegszeit wurde. Nicht nur für den damals knapp 14jährigen Joe Lansdale war er ein „all around good ‚ol American apple-cheeked boy“ – mit dann Schmauchspuren an den rosigen Wangen.
„The Projectionist“ (Der Vorführer) über eine Platzanweiserin in Covid-Zeiten, inspiriert von einem Gemälde von Edward Hopper, schrieb er für eine Anthologie von Lawrence Block, einen seiner Lieblingskollegen. Es wurde auch ein Drehbuch daraus, Joe selbst sollte Regie führen. Aber das Projekt zerschlug sich. In seiner Einführung bezieht er sich auf John Sayles, der Bücher und Geschichten schreibt und ein Filmemacher ist, den habe er immer bewundert. Wenn also jemand eine Million Dollar übrig habe und Joe mal auf dem Regiestuhl sehen wolle, müsse man es ihn nur wissen lassen: „Brown paper bag. Mailbox.“
Einführung und Hintergrund solchen Kalibers gibt es zu jeder der 19 Geschichten (keine „Hap und Leonards“ unter ihnen, weil die alle in Druck sind). Lansdale, bodenständig und nie großspurig geworden, widmet das Buch seinen Lesern mit dem Motto: „To my readers who’ve kept me in beans and biscuits.“ Bohnen und Kekse. Und Bier. So feiern sie in Texas.
Joe R. Lansdale: Things Get Ugly. The Best Crime Stories of Joe R. Lansdale. Tachyon Publications, San Francisco 2023. Trade paperback, 330 Seiten, 18.95 USD.