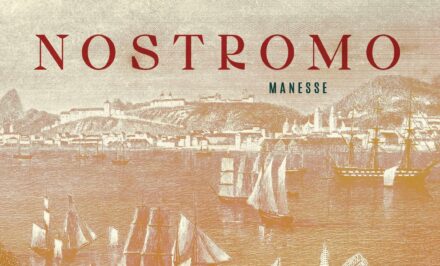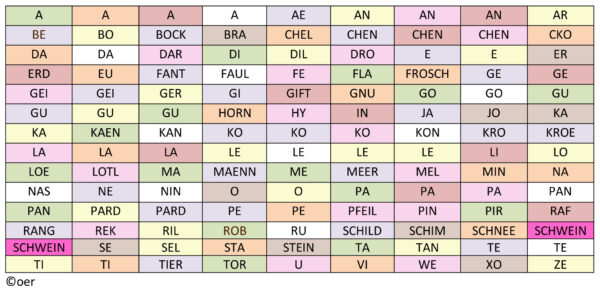Zum literarischen Erbe einer stolzen Tradition
Vorwort von Thomas Wörtche zu dem von ihm herausgegebenen Band ”Berlin Noir«, 2018
Berlin macht es dem Noir nicht leicht. Oder ganz leicht. Die Tradition ist beeindruckend, wirkmächtig und auch beängstigend.
Alfred Döblin, Christopher Isherwood, manche Stücke von Bertolt Brecht, die »Morgue«-Gedichte von Gottfried Benn, »M« von Fritz Lang und viele andere Narrative aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, die allesamt einen tinge of noir haben, haben intellektuelle Maßstäbe gesetzt und literarisch-ästhetische Pflöcke eingerammt, an denen schwer vorbeizukommen ist. Möglicherweise hat deswegen nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin als Schauplatz nennenswerter Kriminalromane kaum stattgefunden, von Ausnahmen wie Ulf Miehes »Ich hab noch einen Toten in Berlin« (1973) und anderen verstreuten Texten vielleicht abgesehen. Für angelsächsische Autoren war Berlin während des Kalten Krieges interessanter – John le Carré, Len Deighton, Ted Allbeury oder Ross Thomas wussten mit der geteilten Stadt wesentlich mehr anzufangen als die meisten deutschen Genre-Autoren, und selbst die heutige »historische« Berlin-Krimi-Welle vor Pappmaché-Kulissen der 1920er und 1930er Jahre hatte vor Jahrzehnten der Brite Philip Kerr begründet. Es dauerte bis weit in die Achtziger- und Neunzigerjahre, bis Berlin von AutorInnen wie Pieke Biermann, Buddy Giovinazzo oder D. B. Blettenberg wieder auf die kriminalliterarische Topografie des dann vereinigten Deutschlands geschrieben wurde, wenn auch mit Texten, die mit Genre-Korsetts wenig zu tun hatten.
Ein Erbe der eben skizzierten stolzen Tradition, die sich auch hier, in »Berlin Noir«, fortschreibt: Weder Döblin noch Benn, Brecht oder Lang beispielsweise haben irgendwelche Formate von Crime Fiction bedient – sie haben nur ihre eigenen literarischen Projekte mit sehr viel noir durchtränkt. Und so steht es auch mit den meisten Texten in unserer Anthologie, sie folgen nicht unbedingt den üblichen Mustern von Crime Fiction, sondern verstehen noir als freestyle, als ein bestimmtes Denken der Großstadt gegenüber, als bestimmte Blicke auf deren Verfasstheit.
Berlin, das notierte schon Franz Hessel, der Flaneur-Bruder im Geiste von Walter Benjamin, ist eine Stadt, die nicht »ist«, eine Stadt, »die immer unterwegs, immer im Begriff ist, anders zu werden«. Stillstand, könnte man sagen, führt zum Tode, wie Robert Rescues Geschichte »Bis irgendwann« zeigt, die nebenbei auch eine schöne Hommage an das Mastul (in der Story die Bar genannt, ein Ort für Veranstaltungen) ist, mitten im Wedding, ein traditionell proletarischer Bezirk, der zunehmend ins Visier der Gentrifizierung gerät, geschrieben in einem Sound, den man als stoischen Wahnsinn beschreiben könnte. Und auch Johannes Groschupfs unsichtbarer Held in »Heinrichplatz Blues« ist plötzlich weg, nachdem er jahrelang zur Freude vieler Frauen durch die Kneipenmeile am Kreuzberger Heinrichplatz gezogen war, die inzwischen ein veritabler Tourist-Spot ist, der von sämtlichen Kreuzberg-Mythen seit den 68er-Zeiten lebt. Nichts bleibt, wie es war – was bleibt, sind ein Rätsel und das sehnsüchtige Echo eines libertären Lebensstils.
Dieser berühmte Lebensstil ist wiederum ein Widerhall der Roaring Twenties, des Zeitalters der ersten sexuellen Emanzipation, die im »Labor der Moderne« gelebt und inzwischen zum verrucht klingenden »Babylon Berlin« verschlagwortet wurde. Sodom und Gomorrha, heute in Ute Cohens giftiger Story »Valverde« zum gelangweilten Spiel der Reichen (und nicht unbedingt Schönen) im schicken und teuren, exklusiven Grunewald verkommen, kein bisschen emanzipatorisch mehr, sondern zwangsläufig gekoppelt mit Gier, Profit und Ausbeutung. Beschreibbar nur noch in einem irrsinnigen Kunstwerk.
Illusionen und Blendwerk auch im hippen In-Viertel Mitte, das zudem immer mehr der artifizielle Ort des Luxus und der Moden wird, zum Ingrimm der alteingesessenen Bevölkerung. Auch wenn die Hipster auf progressiv machen, auf politisch korrekt und ökologisch nachhaltig – kratzt man am Lack, kommen die bekannten kapitalistischen Praktiken zum Vorschein. Die allerdings stinken, wie in Katja Bohnets »Fashion Week«.
Natürlich ist Berlin auch ein Ort, an dem einem, völlig plausibel, die Sicherungen durchbrennen: Was wirklich in dem Kopf von Dora, der – interessanterweise ebenfalls fast unsichtbaren – Hauptfigur von Zoë Becks gleichnamiger Geschichte vorgeht, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass es Aspekte von modern times gibt, die Menschen nicht gut aushalten, selbst wenn ihr Background auf den ersten Blick bürgerlich-solide ist. Dora jedenfalls scheint sich lieber der auch sexuellen Gewalt eines Lebens als Obdachlose rund um den Bahnhof Zoo auszusetzen, anstatt sich den Parametern einer »normalen« Existenz zu fügen. Und wenn man dringend »Normalität« herbeizwingen möchte, wird der Ordnungszwang schnell neurotisch bis psychopathisch, wie in Susanne Saygins Geschichte »Die Schönheit des Zymbelkrauts«, in der die in Schöneberg marodierende Killerin dadurch Ordnung schaffen will, dass sie Vertreter der »bürgerlichen« Ordnung beseitigt, weil in ihrem als botanisches Biotop verstandenen Berlin die gesellschaftliche Diversität nur durch finales Jäten zu sichern ist. Welch ein böses Paradox. Den Kampf um das Verständnis, um die Realität hat der frustrierte Journalist in Ulrich Woelks »Ich sehe was, was du nicht siehst« schon längst radikal verloren, er weiß es nur nicht. Die mediale Durchdringung von Realität und Illusion hat den Filmkritiker, der sich an einer human touch-Story im prekären Teil von Moabit versucht, schon von den Grundlagen der eigenen Existenz entfremdet – er lebt nur noch in Filmen, selbst dann, als er … Aber lesen Sie selbst!
Auch mit der viel beschworenen Identität ist es nicht so einfach in dem Labyrinth der Möglichkeiten, die Berlin für jeden, der damit umgehen kann, anbietet. Tagsüber Biedermann, nachts Mörder, um Karl Marx zu paraphrasieren. Vielleicht eine grausame Überlebensstrategie im besonders vom Party-Tourismus tyrannisierten Friedrichshain rund um den Boxhagener Platz. Um das zu verstehen, ist es möglicherweise opportun, aus dem Ausland zu kommen und den fremden Blick auf die Berliner Verhältnisse zu richten, wie das der italienische Ermittler im Fall von Matthias Wittekindts »Der Unsichtbare« riskiert.
Berlin ist eine relativ friedliche Metropole, zumindest im direkten Vergleich mit anderen Großstädten dieser Welt – das liegt auch daran, dass beispielsweise das organisierte Verbrechen, das hier genauso endemisch ist wie anderswo, strikt darauf achtet, möglichst wenig Kollateralschäden unter unbeteiligten Menschen anzurichten. Was nicht heißt, dass Cops & Gangster kein Thema für »Berlin Noir« wären. Kai Hensel nimmt in »Rammelbullen« einen aktuellen Skandal zum Anlass, eine seltsame Art der Rehabilitation eines in die eheliche Kritik geratenen Polizisten aus dem kleinbürgerlichen Altglienicke ironisch umzusetzen. Ganz Deutschland lachte im Sommer 2017 über eine Berliner Polizeieinheit, die während eines Einsatzes in Hamburg wegen öffentlichem Sex und schwerer Trunkenheit in die Hauptstadt zurückgeschickt wurde. Die Konsequenz in unserer Geschichte: tödliche Schubumkehr.

Blutig wird die Angelegenheit auch bei Miron Zownir, wo korrupte Bullen und veritable Gangster aneinandergeraten: »Überstunden«. Dass die Geschichte sich zwischen Kreuzberg und Neukölln hin- und herbewegt, spricht nicht für eine besondere Kriminalitätsrate dieser beiden Bezirke – Berlins fünfzehn Bezirke sind nur politische Einheiten, die sozial relevante Einheit ist der Kiez, und diese Kieze können innerhalb der Bezirke völlig unterschiedliche Lebens- und Verbrechensräume schaffen, untereinander so fern wie der Mond. Deswegen ist das Neukölln, das uns Max Annas vorstellt, eine ganz andere Art von Welt. Und auch seine Figuren, obwohl sicher nicht »Biodeutsche«, gehören zur normalen vielfältigen Bevölkerung einer Metropole. Dem Typen, der in »Local Train« im Sack steckt, gefällt das nicht. Deswegen gehört er auch in den Sack.
Bleibt die Geschichte. Die ist in Berlin auf Schritt und Tritt gegenwärtig, die Stadt ist vollgesogen mit Geschichte voller Blut und Tod und Gewalt. Die Echos der Nazizeit sind in Michael Wuligers »Kaddisch für Lazar« noch deutlich zu spüren, obwohl es eine ganz heutige und ironische Geschichte über das jüdisch-deutsche Verhältnis ist, besonders lebhaft spürbar im »Neuen Westen«, sehr deutlich in Charlottenburg. Rob Alef hingegen beschäftigt sich in »Dog Tag Afternoon« mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs, genauer mit der Luftbrücke 1948/1949, die mehr mit der Westbindung Deutschlands zu tun hat als viele andere Aktionen der Westalliierten. Geschichte bricht sich auch hier ihre Bahn aus der eben nicht zu beerdigenden Vergangenheit ins Jetzt, genau in diesem Tempelhof, in dem die amerikanischen und britischen Flugzeuge die sowjetische Blockade durchlöchert hatten.
Berlin, so wollten wir zeigen, ist »Synchronie-City« (Pieke Biermann), eine Stadt der disparatesten und diversesten Gleichzeitigkeiten, fest mit ihrer politischen und literarischen Geschichte verzurrt und nach vorn immer in Bewegung. Noir sowieso, und das konstitutiv. Insofern ist »Berlin Noir« eine Momentaufnahme – und wenn ich das im Januar 2018 schreibe, vertrauen Sie mal lieber nicht darauf, dass alles im Januar 2019 nicht schon wieder ganz anders aussieht.
Thomas Wörtche, Berlin 2018
Thomas Wörtche (Hrsg.): Berlin Noir. Mit Originalgeschichten von Rob Alef, Max Annas, Zoë Beck, Katja Bohnet, Ute Cohen, Johannes Groschupf, Kai Hensel, Robert Rescue, Susanne Saygin, Matthias Wittekindt, Ulrich Woelk, Michael Wuliger, Miron Zownir. Paperback. CulturBooks, Hamburg 2018. 336 Seiten, 15 Euro, undnatürlich auch als eBook. – Verlagsinformationen CulturBooks hier. Textauszug mit freundlicher Hilfe und Genehmigung des Verlags.