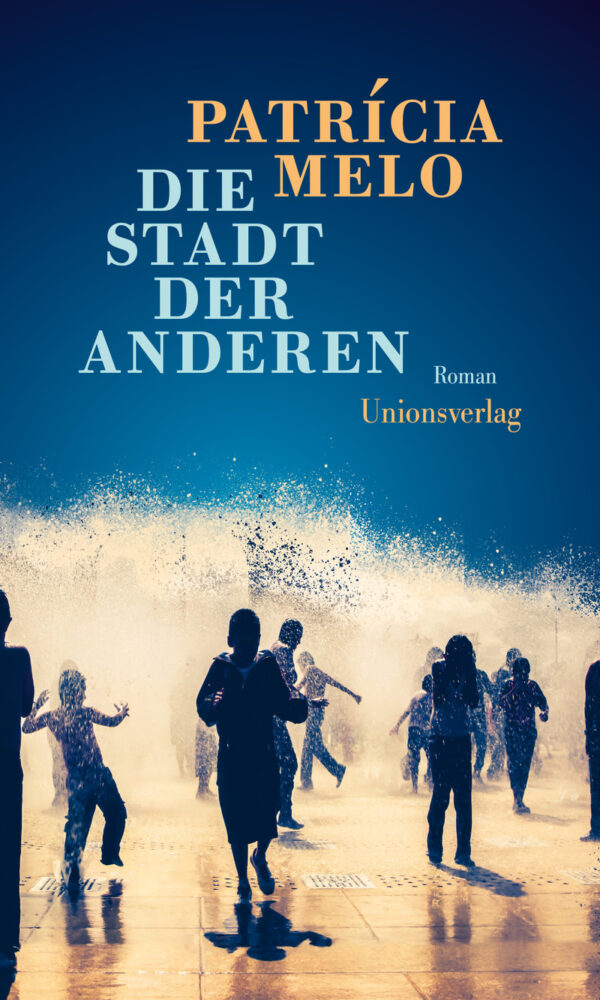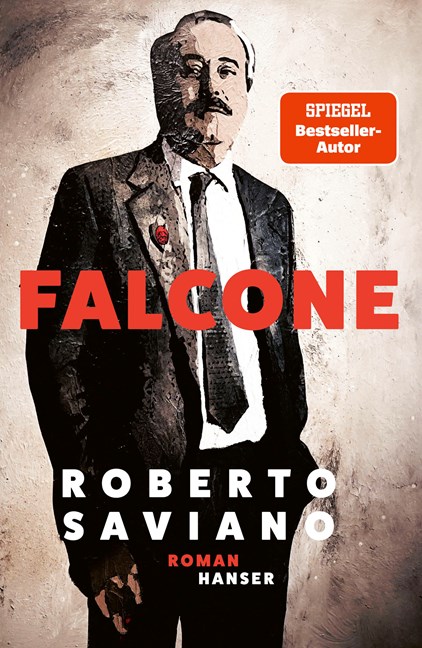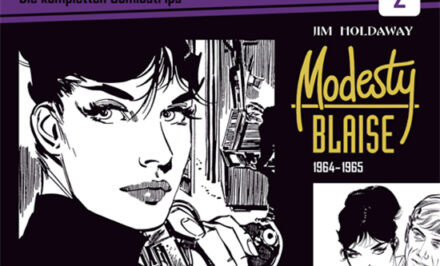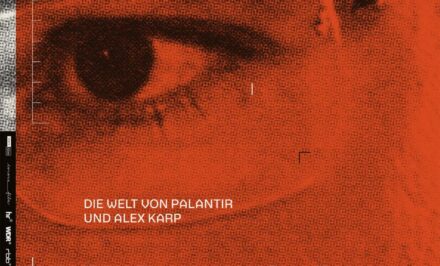Alle Kunst entwickelt sich, also auch Literatur, also auch Kriminalliteratur. Das passiert nicht immer revolutionär, im Fall der Kriminalliteratur über nun fast 150 Jahre eher evolutionär. Zwar spielt gegenüber anderen Sortierungen von Literatur der berühmte „Markt“ bei der Kriminalliteratur eine etwas andere Rolle, weil sie im Großen und Ganzen nicht subventioniert und von den üblichen Strukturen des „Literaturbetriebs“ ungedeckt ist. Das ist zwar ein intellektuelles Armutszeugnis (und/oder intendierte Strategie kulturpolitischer Unsouveränität, Angstbeißen oder was weiß ich was), hat aber immerhin den Vorteil, dass der Kriminalliteratur dadurch ein zusätzlicher Muskel gewachsen ist für die Antagonismen auf dem literarischen Feld.
Anyway, betrachtet man nur den Markt, d.h. die Bestseller, die angeblich so beliebten Destination-Krimis, die Regio-Krimis, die diversen Schlachteplatten und – gerade mal gern genommen – die Selbstverzwergungstexte wie Erdmännchen- oder Menopausenkrimis, die sich in die lange Reihe der Deich-Friesen-Allgäu-Knödel-Achtsammorden-Krimis fügen, betrachtet man die ewigen Golden-Age- und nachgebauten Fake-Golden-Age-Krimis, die immer noch den Kampf der Ladies Christie, Sayers oder Tey gegen die Moderne nachspielen, könnte einem Angst und Bange werden. Auch weil so viel biederer Retro-Geist in die politische Großwetterlage passt, die die von der Komplexität der Welt anscheinend überforderte Leserschaft zu den simplen Gedanken und Gefühlswelten von „damals“ greifen lässt.
Aber: Die Kriminalliteratur hat aus anderen Krisenzeiten und politisch-gesellschaftlichen Großkonstellationen heraus immer neue Impulse geschöpft – Dashiell Hammett gegen das papierne Golden Age und dessen ästhetischen und ideologischen Implikationen, und angesichts der soziopolitischen Realität seiner Ära, Chester Himes aus der Bürgerrechtsbewegung, Jean-Patrick Manchette aus der Studentenbewegung, John LeCarré & Co aus dem Kalten Krieg, Sara Paretsky & Co. aus der Frauenbewegung. Und das eben nicht nur thematisch, sondern auch literarisch-ästhetisch. „Der Markt“ feierte währenddessen ganz andere Texte, an die sich kein Mensch mehr erinnert, zurecht. Will heißen: Der Markt regelt vieles, aber in aestheticis bei weitem nicht alles. Das ist so ähnlich wie beim Film, wo vor Fassbinder, Herzog, Wenders & Co. lange „Die Trapp Familie“, „Schulmädchen Report“ und „Fuck Ju, Göthe“ kommen, wenn man nur dem Markt glaubt. Deswegen muss man sich von dem Getöse nicht blenden lassen, sondern, glauben Sie mir, es macht viel mehr Lust und Spaß sich auf solche Romane einzulassen, in denen es eine Menge mehr zu entdecken gibt, als die öden, zigtausendfach reproduzierten Stories, die von mir aus getrost von der KI geschrieben und gleich auch von der KI konsumiert werden können.
Bemerkenswert finde ich aber eine Tendenz, die man an einer ganzen Reihe aktueller hochqualitativer Romane bemerken kann. Es sieht demnach so aus, dass ein Pfeiler von Kriminalliteratur gekippt werden könnte, den man, zumindest aus literaturpolizeilicher Sicht, gerne für eine conditio sine qua non hielt: Der Plot. „Sauber geplottet“ – das ist schon immer ein Lob gewesen, das alle anderen möglichen Schwächen literarischer oder konzeptioneller Natur zudecken konnte.
Wie aber, wenn „der Plot“ gar nicht so zentral wäre, ohne dem Konstrukt „Kriminalroman“ zu schaden? Nehmen wir Patrícia Melos „Die Stadt der Anderen“ (Ü: Barbara Mesquita), Adam Morris‘ „Bird“ (Ü: Conny Lösch), Gaea Schoeters‘ „Trophäe“ (Ü: Lisa Mensing), Lavie Tidhars „Maror“ (Ü: Conny Lösch) oder Roberto Savianos „Falcone“ (Ü: Annette Kopetzki) – fast alle diese Titel stehen/standen auf der aktuellen „Krimibestenliste“ von Deutschlandfunk Kultur -, dann stellen wir fest, dass sie alle zwar zwischendurch kleinere Subplots, aber keinen dominanten Hauptplot haben, weil sie oft in Bögen erzählen, die lediglich personell oder leitmotivisch verknüpft sind.
Zwar haben Autoren wie Chester Himes, Joseph Wambaugh, James Ellroy oder Don Winslow schon ähnliche Strukturen benutzt (wobei wie immer gilt: Strukturanalogien sind nicht zwangsläufig Funktionsanalogien), aber die Häufung (ich könnte noch ein paar Namen der ersten Garnitur mehr aufzählen) ist schon auffällig. Und bezeichnend, weil es einen Punkt berührt, dem notorisch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: die berühmte Meaning of Structure, ohne deren Beachtung Literaturbetrachtung ziemlich naiv wäre. Heißt: Wenn es keinen Hauptplot gibt, signalisiert das auch, dass „Verbrechen“ nicht mehr auf das einzelne Skandalon zu reduzieren ist (auch als Gegenrede zu „True Crime“); ein Skandalon zudem, das mit der „Aufklärung“, mit dem „Fall“ abzuschließen wäre. Damit streift die seriöse Kriminalliteratur nicht nur endgültig ein konzeptuelles Element von Formula Fiction ab, sondern auch das dem Fall-Aufklärungsschema implizite ordnungspolitische Dogma, dass das „Verbrechen“ erfolgreich und letztendlich final bekämpft werden kann. Zudem wird damit der Definitionsrahmen dessen, was als Verbrechen kriminalliterarisch behandelt werden kann und behandelt werden sollte, erheblich erweitert. Lesen Sie daraufhin mal Gaea Schoeters „Trophäe“. Kriminalliteratur pur, ohne Leitplanken.
© 05.2024 Thomas Wörtche