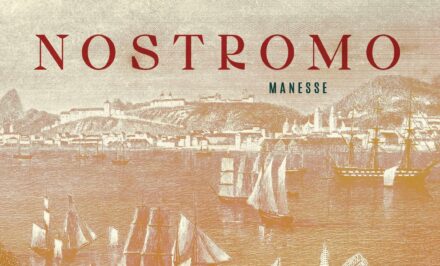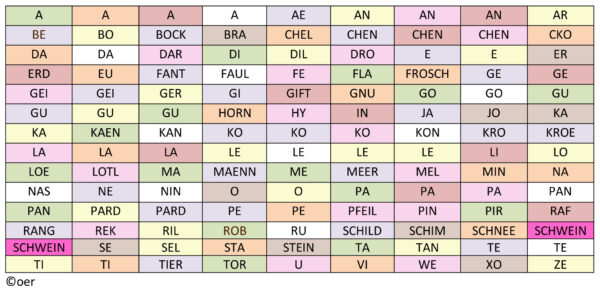Am Anfang stand ein Verdacht
Man wird kaum gefragt, wann man angefangen hat, Bücher zu lesen. Man wird jedoch relativ oft gefragt, wie man zum Lesen von Kriminalromanen gekommen ist. Da steckt schon ein klein wenig Voyeurismus drin, so etwa: Wann hast Du Deine erste Zigarette, Deinen ersten Suff, Dein erstes…. Und so weiter. Und dann, werden sie meistens auch brav abgeliefert, die kriminalliterarischen Initiationserlebnisse: Unter der Bettdecke, heimlich, meine Eltern wollten das nicht…. Und natürlich Geständnisse, die menschlich sind, allzu menschlich. Je nach Generation „Drei Fragezeichen“, Edgar Wallace, Enyd Blyton, Jerry Cotton, Agatha Christie, so Sachen. Man kennt die Rituale und die pawlowschen Antworten.
Damit kann ich nicht dienen. Ich habe früh angefangen zu lesen, kreuz und quer, Akzent Stevenson, Cooper, C.S. Forester, um dann zum Snob mit viel Distinktionsgewinn in meinem Umfeld zu werden: Musil, Proust, Joyce, Thomas Bernhard, Kafka und alle Surrealisten, und Alfred Jarry und… Wenn mir ein Krimi begegnete, wurde er sofort verachtet – Agatha Christie, was für arg schlichte Gemüter, Dorothy Sayers, konservativer Unfug, Jerry Cotton, was für’n Wannabe-Quatsch. Und als juicy books hatte man die Mutzenbacher, Oscar Wilde, da brauchte man keinen James Hadley Chase, Carter Brown und Konsorten.
Die Attitüde von damals war peinlich, der jugendliche Sturm und Drang hochfahrend und –trabend.
Also – so falsch lag ich gar nicht. Ich kann immer noch nichts mit Krimis anfangen, die den Mörder suchen, den sie selbst versteckt haben, oder welche, die ein paar Jahre oder Jahrzehnte später auf irgendwelchen Zeitgeistwellen daher gesurft kommen, die im Nicht-Krimiland schon längst durch sind, oder die Simplifizierung zu ihrem Geschäft machen und so was dann als wahrhaft populär ausgeben, weil doch der Leser ein recht schlichtes Kerlchen oder Mädel sei, für den man alles Mündchens Maß vorkauen muss. So ein Leser wollte ich nicht sein und war es auch nicht. Deshalb war ich von Krimis wenig beeindruckt. Lange, lange Lesejahre. Dann kam die Science Fiction, so Ende der 1960s, Anfang der 1970s. Und Mitte der 1970 Eric Ambler, Ross Thomas, Chester Himes…
Und es gab einen herben Rückschlag, als ich an der Uni in einer Art „Literarischem Kolloquium“ einen frühen Roman von –ky verteidigen musste. Man hat dort debattieren gelernt, indem man einen Roman oder Gedichtband oder was auch immer gegen die massive Kritik aller anderen auf Biegen oder Brechen defendieren musste – oder man ging unter. Mit wehender Fahne oder gurgelnd. Ich hatte –ky gewählt, um zu zeigen: Hier, Leute, es gibt auch deutsche Krimis, die sogar von Hochschullehrern geschrieben werden… Leider hatte ich das Teil vorher nicht gelesen. Ich ging unter. Gurgelnd. Und vor allem zu Recht. Das Buch, ich habe verdrängt welches, war so grottig, dass meine Mitdiskutanten darüber herfielen wie ein Schwarm Wanderameisen über eine tote Maus, und das mit allen guten Gründen der Welt, und retten konnte ich es beim besten Willen nicht. Es war keine „Literatur“, und es war keine keine „Literatur“, also kein Pulp oder Trash oder so, was leicht zu verteidigen gewesen wäre. Es wollte Krimi und gleichzeitig literarisch sein, spannend, aber gleichzeitig ein moralischer Diskurs, es wollte links und radikal sein, und man spürte den Beamtenstatus des Autors in jeder Zeile. Und es machte es den Snobs unter den Kriminalverächtern sehr, sehr leicht, es zu zernichten. Und auch das völlig zu Recht.
Nun wird man aus gekränkter Eitelkeit heraus nicht unbedingt zum Fan von irgendwas. Ich wurde auch kein „Freund“ der Kriminalliteratur, so wie man zum Freund dunklen Bieres wird, ihr Fan schon gar nicht. Ich „liebe“ Kriminalliteratur nicht, ich liebe den einen oder anderen Menschen, mehr schaff ich nicht. Und Artefakte wollen auch nicht geliebt werden, das ist der neue Gefühligkeitskitsch, der aus vielen Ecken der sozialen Netzwerke quillt und vor allem der schlimmste aller Lektürehaltungen, dem identifikatorischen Lesen, als emotionaler Kleister dient.
Und gerade mit Gefühligkeit hat Kriminalliteratur wenig zu tun. Kleine, einsame Eisinseln, nannte Jerome Charyn einmal sinngemäß die Prosatexte von Dashiell Hammett. Die kühle Eleganz eines Eric Ambler und der Witz und die Intelligenz on the rocks, die die Romane von Ross Thomas auszeichneten, all das hatte die „seriöse“ Literatur nur in den wenigsten Fällen zu bieten und schon gar nicht im Zusammenhang mit Themen wie Steuervermeidung, der Korruption von Staatsmännern oder der Austauschbarkeit von Kriminalität und kapitalistischem Wirtschaftsgebaren. Sie konnte, und so begann meine Geschichte mit der Kriminalliteratur, was andere Literatur nicht konnte. Oder sie konnte es zumindest besser. Besser heißt: intelligenter, leichtfüßiger, witziger, analytischer, akrobatischer, spannender, unterhaltsamer, klüger und vor allem radikaler. Das Allerschönste: Es stand nicht in Leuchtschrift drauf, es wurde kein Bohei darum gemacht.

Das Gemachtsein, das Artifizielle von Texten musste nicht ihr Thema sein, denn obwohl sie hochartifiziell waren und sind, haben sie Sachen zu erzählen: Stoffe, Thema, Plot. Dinge, die, würden sie anders erzählt, auch anders wahrgenommen würden. Oder gar nicht. Oder nur am Rande. Da, wo man „Kriminalität“ am liebsten hätte, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Realität. Deswegen hat man ja gern schlechte Kriminalliteratur, die sich auch noch als Literatur fühlt, in manchen Kreisen am liebsten. Dort rückt sie in die Mitte der literarischen Gesellschaft, weil man ihre hanebüchenen Plots und Stoffe nicht so ernst nehmen muss und sie auf Kosten ihrer Literarizität ignorieren kann. Und diese „Literarizität“ ist dann auch meistens noch ziemlich inferior. Die Pfauenräder, die heute mediokre Autoren wie Henning Mankell oder Jo Nesbø schlagen, wenn sie als die Shakespeares von heute das Publikum beeindrucken wollen, hätten Eric Ambler oder Ross Thomas ein mildes Lächeln entlockt. Wenn überhaupt, während sie die eigentlichen Beiträge zu Comédie Humaine verfassten.
Es geht um Anfänge und um Beginn. Nicht darum, dass früher alles besser war. Tatsächlich konnte man vielleicht durch die offene Lektüre von Kriminalromanen symbolischen Distinktionsgewinn in sozialen verwandeln, während man heute, wo alle Welt „Krimis“ liest, sich als deren Verächter positionieren kann (wobei man aber schon wieder verloren hätte, weil man zeigt, dass man die wirklich coole Kriminalliteratur nicht kennt und bloß Donna Leon verachtet – Sie sehen, es wird kompliziert!), aber das ist sooo interessant auch wieder nicht.
Interessanter ist, ob man die Welt anders sieht, wenn man in den intellektuellen Prägejahren eine bestimmte Literatur gelesen oder nicht gelesen hat. Ist, wer Naturlyrik liest, lyrisch gestimmt? Liest, wer meint, die Welt sei zu enträtseln, Agatha Christie? Oder lesen Finanzmanipulatoren Eric Ambler, weil sie sich von ihm verstanden wissen? Und welches Bild haben junge Leser von heute vom Umgang der Geschlechter, wenn sie hauptsächlich Thriller lesen, in denen Frauen zerteilt, gemartert und geschändet werden, gewohnheitsmäßig, sozusagen? Oder lesen sie Thriller, in denen Frauen zerteilt, gemartert und geschändet werden, weil sie sowas aus der Realität nicht kennen, es aber gerne würden (kennen oder gar selber tun)? Oder weil sie es sich selbst nicht trauen, sich aber von den Cleaves, Etzolds & Co. verstanden fühlen? Und warum sind viele dieser Leser weiblich? Wo liegen da die Anfänge? Sind Lektüreprägungen auch ästhetisch-moralische Prägungen? Habe ich als Patricia-Highsmith-Leserin notwendigerweise den bösen Blick auf meine Mitmenschen? Oder lese ich Patricia-Melo-Romane, weil ich das Gefühl habe, sie können mir mit ihrer Kunst noch neue scheußlich-komische Facetten von homo sapiens zeigen, auf die ich selbst noch nicht gekommen bin?
Auf der Ebene verschwinden dann übrigens wieder die Unterschiede. Ich kann mir auch von William Shakespeare ein paar wirklich üble Nummern über unsere Spezies verpassen lassen, auf die ein Schlachteplattenanrichter wie Wulf Dorn ein paar hundert Jahre später immer noch nicht gekommen ist. Während umgekehrt eine gut/böse-Gemengelage à la Jerome Charyn auch einen Renaissancepapst zum Grübeln gebracht hätte.
Kriminalliteratur war dann nur noch formal zu unterscheiden. Und genau wegen ihrer formalen Unterscheidbarkeit mochte ich sie in meinen und in ihren genrehistorischen Anfängen überhaupt nicht.
Ein Grundparadox? Eigentlich nicht, aber schon wichtig, weil da der missglückte Anfang zu dem eher fröhlichen (na ja vorläufigen) Ende führt, dass Kriminalroman, Thriller oder welche Schublade auch immer wir bemühen wollen, eben keine „Form“ sind, sondern nur verschiedene Arten, die Welt zu erzählen. Eine „Formel“ braucht es nicht, ein paar Standardsituationen schon (aber die braucht jeder narration zur schnellen Verständigung über das, das der Fall ist), den Rest erledigt der Plot – und der ist sprachlich, also ästhetisch organisiert.
Deswegen sind Romane von Ross Thomas, Elmore Leonard und Robert Littell Kunstwerke der Entgrenzung Sie sabotieren die U/E-Grenzen, die Grenzen von Fiktion und Realität, von Wahrheit und Lüge, von Gewissheit und Skepsis. Sie mischen die Verhältnisse von kreativer Distanz und emotionaler Identifikation neu. Sie beschäftigen sich mit Atavismen wie Gewalt und Macht und spüren sie in der Mitte der Gesellschaft auf, wo sie ansonsten sehr aufwändig verdrängt werden oder als umhegt und eingefriedet gelten.
Am Anfang stand der Verdacht, dass Crime Fiction alles das könne. Hier und heute könnte man allmählich anfangen, es zu akzeptieren.
Thomas Wörtche, aus „Penser Polar“, Polar Verlag 2015. – Der Band versammelte die TW-Kolumnen, die von 2013 bis 2015 monatlich in der „Polar Gazette“ erschienen sind.