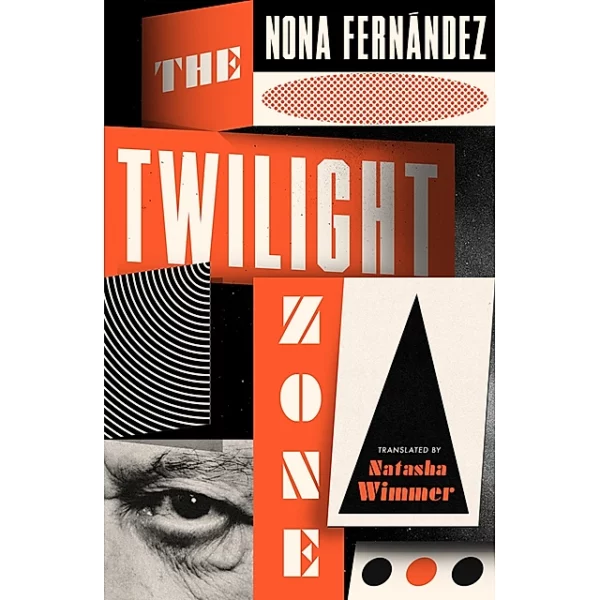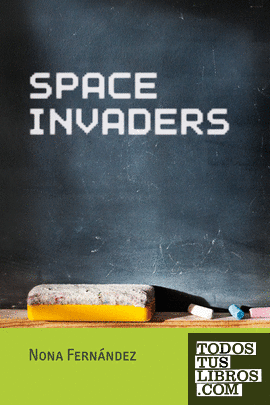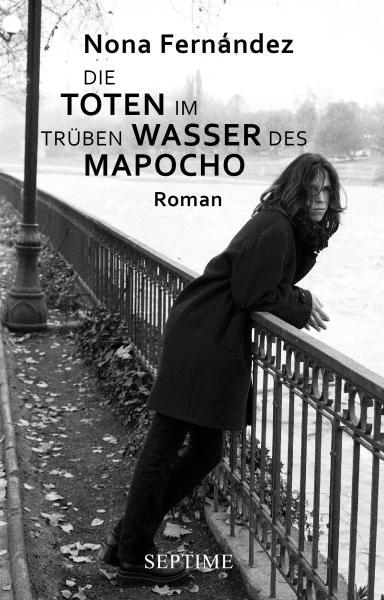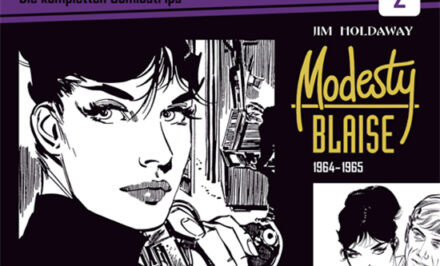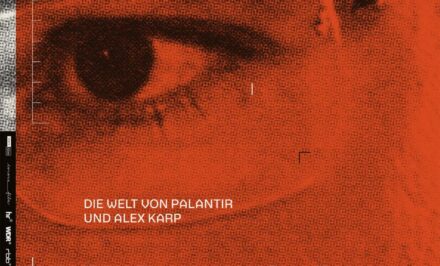Die Zeit, als die Menschen verschwanden
Die Erzählerin in Nona Fernández’ Roman ist noch ein Kind, als sie auf dem Titelblatt der Zeitschrift das Gesicht des Mannes sieht, daneben der Satz: »Ich habe gefoltert.« Die wahre Geschichte dieses reumütigen Geheimagenten, seine Mitschuld an den schlimmsten Verbrechen des Regimes, aber auch sein Wille, die Dinge aufzuklären, beschäftigen die Erzählerin, inzwischen eine erfolgreiche Journalistin und Dokumentarfilmerin, auch noch lange nach dem Ende der Diktatur. Nach und nach rekonstruiert sie das Leben des Mannes und folgt ihm an Orte, die Archive nicht vermitteln können: in die düsteren Grauzonen und Abgründe der Geschichte, wo ganz normale Tagesabläufe, Spieleabende, Popsongs oder Fernsehserien direkt neben den brutalen Machenschaften des Regimes existieren, in dem es zum Alltag gehörte, dass Menschen spurlos verschwanden.
Nona Fernández: Twilight Zone (La dimensión desconocida, 2016). Aus dem chilenischen Spanisch von Friederike von Criegern. CulturBooks, Hamburg 2024. 238 Seiten, Hardcover, 24 Euro. – Verlagsinformationen zum Buch hier. Textauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
** **
Ich stelle mir vor, wie er eine Straße im Zentrum entlanggeht. Ein großer, schlanker Mann mit schwarzem Haar und einem buschigen, dunklen Schnauzbart. In der linken Hand hält er eine gefaltete Zeitschrift. Er drückt sie zusammen, als müsste er sich beim Gehen daran festhalten. Ich stelle mir vor, dass er in Eile ist, er raucht eine Zigarette und schaut sich nervös um, will sichergehen, dass ihm niemand folgt. Es ist August. Genauer gesagt der Morgen des 27. August 1984. Ich stelle mir vor, wie er ein Gebäude in der Calle Huérfanos Ecke Bandera betritt. Es sind die Redaktionsräume der Zeitschrift Cauce, aber das stelle ich mir nicht vor, das habe ich gelesen. Die Rezeptionistin erkennt ihn. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit der immer gleichen Bitte kommt: Er müsse mit der Journalistin sprechen, die den Artikel in der Zeitschrift geschrieben hat, die er bei sich trägt. Die Frau an der Rezeption kann ich mir schlecht vorstellen. Ihr Gesicht will einfach nicht scharf werden, nicht einmal den Ausdruck, mit dem sie diesen nervösen Mann anschaut, kann ich mir ausmalen, aber ich weiß, dass sie ihm und seiner Dringlichkeit misstraut. Ich stelle mir vor, wie sie versucht, ihn abzuwimmeln, wie sie ihm sagt, die Person, die er sucht, sei nicht da, sie werde auch den ganzen Tag nicht mehr kommen, er solle nicht insistieren, er solle gehen, er solle nicht wiederkommen. Ich stelle mir auch vor – denn das ist meine Rolle in dieser Geschichte –, wie die Szene von einer Frauenstimme unterbrochen wird, die ich, wenn ich beim Schreiben die Augen schließe, hören kann.
Der Mann sieht die Frau, die ihn angesprochen hat, genau an. Wahrscheinlich kennt er sie. Er wird sie vorher auf irgendeinem Foto gesehen haben. Vielleicht hat er sie mal überprüft oder ihre Akte gelesen. Sie ist die Person, die er sucht. Die den Artikel geschrieben hat, den er gelesen und bei sich hat. Er ist sich sicher. Darum geht er auf sie zu, streckt ihr die rechte Hand entgegen und zeigt ihr seinen Mitgliedsausweis der Streitkräfte.
Ich stelle mir vor, dass die Journalistin so etwas nicht erwartet hat. Verwirrt schaut sie den Ausweis an. Ich könnte ergänzen: erschrocken. Andrés Antonio Valenzuela Morales, Gefreiter, Personalausweis Nr. 39.432 der Gemeinde La Ligua. Neben dieser Information ein Foto mit der Dienstnummer 66.650, das stelle ich mir nicht vor, das lese ich hier, in seiner Zeugenaussage, die dieselbe Journalistin sehr viel später niedergeschrieben hat.
»Ich möchte Ihnen erzählen, was ich getan habe«, sagt der Mann und schaut ihr in die Augen, und ich stelle mir vor, dass seine Stimme ein wenig zittert, als er diese Worte ausspricht, die ich mir nicht vorstellen muss: »Ich möchte Ihnen vom Verschwindenlassen von Menschen erzählen.«
Das erste Mal sah ich ihn auf einem Zeitschriftencover. Es war eine Ausgabe von Cauce, eine der Zeitschriften, die ich las, ohne zu begreifen, wer die Protagonisten all dieser Titelgeschichten waren, die von Attentaten, Entführungen, Operationen, Verbrechen, Betrugsfällen, Klagen, Anzeigen und anderen reißerischen Vorfällen jener Zeit berichteten. »Mutmaßlicher Bombenleger war lokaler Leiter der CNI«, »La Moneda wird weiterhin von den Enthaupteten heimgesucht«, »Der Plan zur Ermordung von Tucapel Jiménez«, »Hat die DINA die Erschießungen von Calama angeordnet?« Mit dreizehn Jahren prägten diese Zeitschriften meine Lesart der Welt, sie gehörten nicht mir, sondern uns allen, und sie wanderten unter meinen Schulkameraden von Hand zu Hand. Aus den abgedruckten Fotos setzte sich ein verwirrendes Bild zusammen, auf dem ich mich nie zur Gänze orientieren konnte, aber die düsteren Details irrlichterten in meinen Träumen umher.
Ich erinnere mich an eine erfundene Szene. Ich selbst habe sie mir auf der Grundlage eines Artikels vorgestellt. Auf dem Titelblatt war die Zeichnung eines Mannes auf einem Stuhl, die Augen verbunden. Im Heft selbst fand sich dann eine Art Katalog aller bis zu diesem Zeitpunkt dokumentierten Foltermethoden. Dort las ich die Aussagen einiger Opfer und sah Schaubilder und Zeichnungen, die aus einem mittelalterlichen Buch hätten stammen können. Ich kann mich nicht an jedes Detail erinnern, aber den Bericht eines jungen Mädchens von 16 Jahren habe ich in lebhafter Erinnerung. Sie erzählte, wie sie ihr in dem Folterzentrum, in dem sie war, die Kleider ausgezogen, sie von oben bis unten mit Exkrementen eingeschmiert und dann in einen dunklen Raum voller Ratten gesperrt hatten.
Ich wollte es nicht, aber es war nicht zu vermeiden, dass ich mir diesen dunklen Raum voller Ratten vorstellte.
Ich träumte von diesem Ort und schreckte oft aus diesem Traum hoch.
Bis heute muss ich ihn verscheuchen, und vielleicht schreibe ich das hier nur auf, um ihn abzuschütteln.
Der Mann, den ich mir vorstelle, ist ein Erbstück aus demselben Traum, oder vielleicht aus einem anderen, ähnlichen. Ein gewöhnlicher Mann, ohne besondere Merkmale, außer diesem buschigen Schnauzbart, der zumindest meine Aufmerksamkeit erregte. Sein Gesicht auf dem Titelblatt einer der Zeitschriften, und über dem Foto eine Schlagzeile in weißen Lettern: ICH HABE GEFOLTERT. Darunter ein weiterer Satz: ENTSETZLICHE ZEUGENAUSSAGE DES GEHEIMDIENSTAGENTEN. Im Inneren des Hefts lag eine Sonderbeilage mit einem langen Exklusivinterview. Darin zeichnete der Mann seinen gesamten Lebensweg als Geheimdienstagent nach, vom Beginn als junger Wehrpflichtiger bei der Luftwaffe bis zu genau diesem Augenblick, in dem er bei der Zeitschrift Zeugnis ablegte. Seitenweise detaillierte Informationen über das, was er getan hatte, mitsamt der Namen von Agenten, von Gefangenen, von Denunzianten, mit den Adressen der Folterzentren, der Angabe von Orten, an denen die Leichen vergraben worden waren, mit präzisen Schilderungen spezifischer Foltermethoden, mit Berichten von vielen Operationen. Hellblaue Seiten, daran erinnere ich mich genau, auf denen ich für eine Weile in eine Art Parallelwelt eintrat, unendlich und dunkel, so wie dieser Raum, von dem ich träumte. Ein beunruhigendes Universum, das wir dort draußen vermuteten, verborgen weit jenseits der Grenzen unserer Schule und unserer Häuser, ein Universum, in dem alles nach einer Logik geschah, die vorgegeben wurde von den Regeln des Eingesperrtseins und der Ratten. Eine Gruselgeschichte mit einem ganz gewöhnlichen Mann in der Doppelrolle als Erzähler und Hauptfigur; er erinnerte an unseren Physiklehrer, fanden wir, mit genauso einem buschigen Schnauzbart. Der Mann, der gefoltert hatte, sprach in dem Interview nicht über Ratten, aber er hätte ohne Weiteres ihr Dompteur sein können. Ich vermute, genau das habe ich mir vorgestellt. Einen Rattenbeschwörer, der eine Melodie spielte, die sie zwang, ihm zu folgen, der ihnen keine andere Möglichkeit ließ, als im Gänsemarsch vorwärtszugehen und diesen beunruhigenden Ort zu betreten, den er bewohnte. Er sah nicht aus wie ein Monster oder ein bösartiger Riese, auch nicht wie ein Psychopath, vor dem man weglaufen sollte. Er sah nicht mal aus wie diese Polizisten mit ihren Knobelbechern an den Füßen, Helmen und Schilden, die uns bei den Demos mit Schlagstöcken verdroschen. Jeder konnte der Mann sein, der gefoltert hatte. Auch unser Lehrer an der Oberschule.
Das zweite Mal sah ich ihn fünfundzwanzig Jahre später. Ich arbeitete an dem Drehbuch für eine Fernsehserie, in der einer der Protagonisten durch ihn inspiriert war. Die Serie war fiktional, mit jeder Menge Romantik, wie es im Fernsehen eben sein muss, aber um die Zeit, in der sie spielte, genau abzubilden, brauchten wir auch Verfolgung und Tod.
Die Figur, die wir entwickelten, war ein Geheimdienstler, der, nachdem er an Operationen teilgenommen hatte, bei denen er Leute festnahm oder folterte, wieder nach Hause ging, eine Kassette mit romantischen Liedern anhörte und seinem Sohn zum Einschlafen Spiderman-Comics vorlas. Zwölf Folgen lang begleiten wir sein Doppelleben, diese vollständige Trennung des Privaten und Beruflichen, die ihn insgeheim belastet. Er fühlt sich mit seiner Arbeit nicht mehr wohl, sein Nervenkostüm wird durchlässig, die Beruhigungsmittel wirken nicht, weder isst er, noch schläft er, er redet nicht mehr mit seiner Frau, umarmt sein Kind nicht mehr, trifft sich nicht mehr mit Freunden. Er ist verängstigt, fühlt sich krank und von den Vorgesetzten unter Druck gesetzt, gefangen in einer Realität, aus der er keinen Ausweg sieht. Zum Höhepunkt der Serie sucht er seine eigenen Feinde auf und überreicht ihnen in einem verzweifelten Akt der Katharsis und der Erleichterung die brutale Aussage über alles, was er als Geheimdienstagent getan hat.
Im Zuge der Arbeit an dem Drehbuch setzte ich mich wieder mit dem Interview auseinander, das ich als Jugendliche gelesen hatte.
Ich sah ihn erneut auf dem Titelblatt.
Sein buschiger Schnauzbart, seine dunklen Augen, die mich aus der Zeitschrift, von der anderen Seite, anblicken, und dieser Satz über seinem Foto: ICH HABE GEFOLTERT.
Die Faszination war ungebrochen. Wie eine Ratte wurde ich wieder in seinen Bann gezogen, war bereit, ihm zu folgen, wohin auch immer mich seine Aussage führte. Zeile für Zeile las ich, was er sagte. Nach fünfundzwanzig Jahren hatten sich einige Bereiche meiner diffusen Landkarte geschärft. Jetzt konnte ich klar und deutlich erkennen, wer sich hinter diesen Decknamen verbarg und welche Rolle sie spielten. Oberst Edgar Ceballos Jones von der Luftwaffe; General Enrique Ruiz Bunguer, Chef des Nachrichtendienstes der Luftwaffe; José Weibel Navarrete, Anführer der Kommunistischen Partei; der hochverehrte Quila Rodríguez Gallardo, Mitglied der Kommunistischen Partei; Wally, ein Zivilbeamter beim Gemeinsamen Kommando der Streitkräfte; Fanta, ehemaliger Milizionär der Kommunistischen Partei und später Denunziant und Häscher; Fifo Palma, Carlos Con-treras Maluje, Yuri Gahona, Carol Flores, Guillermo Bratti, René Basoa, Coño Molina, Señor Velasco, Patán, Yerko, Lutti, La Firma, Peldehue, Remo Cero, das Nido 18, das Nido 20, das Nido 22, die Geheimdienstgemeinschaft von Juan Antonio Ríos. Die Liste nimmt kein Ende. Wieder trat ich ein in diese dunkle Dimension, dieses Mal jedoch mit einer Taschenlampe, die ich jahrelang aufgeladen hatte und mit der ich mich nun viel besser orientieren konnte. Ihr Licht beleuchtete meinen Weg, und ich hatte die Gewissheit, dass all die Informationen des Mannes, der gefoltert hatte, nicht nur dastanden, um den zeitgenössischen Leser zu überraschen und ihm die Augen für diesen Albtraum zu öffnen, sondern dass sie auch deshalb veröffentlicht worden waren, um die Maschinerie des Bösen zu stoppen. Sie waren der eindeutige und konkrete Beweis, unwiderlegbar und real, eine von der anderen Seite des Spiegels gesendete Botschaft; sie belegten, dass dieses unsichtbare Paralleluniversum wirklich existierte und keine Fantasterei war, wie so oft behauptet.
Zuletzt sah ich ihn vor ein paar Wochen. Ich schrieb an einem Dokumentarfilm von ein paar Freunden über die Vicaría de la Solidaridad, eine katholische Organisation, die mitten in der Diktatur gegründet worden war, um den Opfern des Regimes zu helfen. Der Film dokumentiert die Arbeit der Gegenspionage, die vor allem von den Anwälten und Sozialarbeitern der Organisation geleistet wurde. Bei jedem Fall erzwungenen Verschwindens, von Verhaftung, Entführung, Folter oder jeglicher Art von Gewalt, um den sie sich kümmerten, sammelten sich Zeugenaussagen und Unterlagen an, und dabei tauchten Hinweise auf, die zu einer Art Panorama der Unterdrückung beitrugen. Unermüdlich untersuchte das Team der Vicaría diese Landschaft, sie versuchten, die perfide Logik dahinter zu erkennen, um mit etwas Glück den Aktionen der Agenten zuvorzukommen und Leben zu retten.
Seit Jahren arbeiten wir an diesem Film, und das Material ist so heftig, dass uns manchmal schwindelig wird. Meine Freunde, die Regie führen, haben Stunde um Stunde Interviews mit den Protagonisten der Geschichte geführt. Jeder einzelne erzählt der Kamera, wie er zur Organisation gekommen ist, was dort seine Aufgabe war und auf welch verschlungenen Wegen sie zu Detektiven, Spionen und geheimen Ermittlern wurden. Letztendlich haben sie Informationen analysiert, Vernehmungen durchgeführt, Operationen organisiert, wurden ein Spiegelbild der Geheimdienste des Feindes, nur mit edleren Absichten. Jedes einzelne Interview ist so interessant und von einer solchen Intensität, dass eine Auswahl extrem schwerfällt. Deshalb kann ich mich nur in den frühen Morgenstunden und mit einem starken Kaffee an die Arbeit setzen, ich muss so klar wie nur irgend möglich sein.
Der Morgen, von dem ich erzählen möchte, war ein solcher Morgen. Dusche, Kaffee, Notizbuch, Bleistift und Wiedergabetaste, um den neuen Clip zu starten und durchzusehen. Währenddessen machte ich Notizen, hielt einzelne Bilder an, probierte im Kopf Schnitte aus, hörte mir einige Sätze wieder und wieder an, um zu entscheiden, ob sie nötig waren oder nicht. Ich steckte mitten in den mir wohlvertrauten Aussagen von Zeugen, den Interviews und Bildern aus dem Archiv, die ich Millionen Mal durchforstet hatte, als völlig überraschend er auftauchte: der Mann, der gefoltert hatte.
Er war direkt vor mir. Nun war er nicht mehr nur ein unbewegliches, in einer Zeitschrift abgedrucktes Bild.
Sein Gesicht erwachte auf dem Bildschirm zum Leben, meine alte Faszination war sofort wieder da, und er zeigte sich zum ersten Mal in Bewegung. Seine Augen blinzelten, seine Brauen bewegten sich kaum merklich. Ich erkannte sogar das kaum wahrzunehmende Auf und Ab seines Brustkorbs beim Atmen.
Meine Freunde erklärten mir, es sei ihnen gelungen, ihn bei einem Besuch in Chile zu interviewen. Der Mann war seit den 1980er Jahren nicht mehr im Land gesehen worden, seit er seine Aussage gemacht und Chile dann heimlich verlassen hatte. Dreißig Jahre später kam er wieder, um vor Gericht auszusagen, aber dieses Mal zu konkreten Fällen und vor ein oder zwei Richtern. Es war seine eigene Idee gewesen, sie hatten ihn nicht angerufen. Die Beamten bei der Polizei und im französischen Innenministerium, die all die Jahre für seine Sicherheit verantwortlich waren, hatten sogar versucht, ihn davon abzubringen. Das Bild, das ich an diesem Morgen auf meinem Bildschirm sah, war das eines Mannes, der nach langer Zeit mit der Überzeugung in sein Heimatland zurückgekehrt war, ein Kapitel abschließen zu müssen. So erklärte er es auch selbst im einzigen Interview, das er bei seinem kurzen Aufenthalt in Chile gab.
Jetzt, da ich dies schreibe, friere ich das Bild wieder auf meinem Monitor ein.
Er ist es. Er ist da, auf der anderen Seite des Bildschirms.
Der Mann, der gefoltert hat, sieht mir ins Gesicht, als könnte er mich tatsächlich sehen. Er hat den gleichen buschigen Schnauzbart, aber jetzt ist er nicht mehr schwarz, sondern eher grau, wie auch sein Haar. Seit jenem Foto auf dem Titelblatt der Zeitschrift Cauce sind dreißig Jahre vergangen. Dreißig Jahre, die sich in den Falten auf seiner gerunzelten Stirn verraten, in der Brille mit den selbsttönenden Gläsern, die er jetzt trägt, und in den grauen Schläfen, die ich schon erwähnt habe. Er spricht mit einer Stimme, die ich noch nicht kannte. Er spricht ganz ruhig, nicht so wie damals wahrscheinlich, als er im Jahr 1984 seine Aussage gemacht hat. Seine Stimme ist sogar sanft, schüchtern, ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Man könnte sagen, er beantwortet die Fragen meiner Freunde widerwillig, ohne eigenen Antrieb, aber überzeugt, seine Pflicht zu tun, als würde er den Befehl eines Vorgesetzten befolgen.