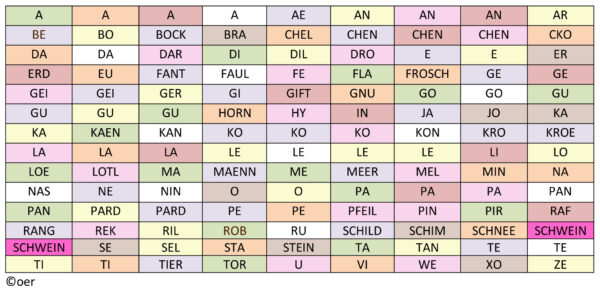Alles Lüge?
Alles Lüge?
Es gibt die Zeitung für Deutschland (FAZ), die Kampagne „Du bist Deutschland“ und nun auch einen „Deutschlandroman“. Der melancholische Titel dieses Buches verspricht viel, wie auch der Alfred-Döblin-, der aspekte-Literatur- und der Deutsche Buchpreis, die dem Autor für sein erstes Prosawerk verliehen wurden, manche Erwartungen wecken. An der Literatur und ihrer Rezeption geschulte Menschen aber wissen, dass Preise und Verkaufszahlen eher etwas über den Zeitgeist als über die Qualität von Literatur aussagen. Und es ist der Zeitgeist, der den Erfolg dieses Romans verständlicher macht als seine Prosa. Von Elfriede Müller
Die Tageszeitung schreibt in ihrer Rezension: „Ein Roman, der die DDR wirklich hinter sich lässt.“ Ja, wer hätte denn gedacht, dass die DDR noch vor uns liegt, uns gar noch bevorsteht? Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass die Zeit nun reif sei für „diesen unverstellten, humorvollen und einfühlsamen Blick“. Verlag und Presse schreiben viel vom Ende der politischen Utopie, von einer endlich ungetrübten Sicht auf ein vor 22 Jahren untergegangenes Land, dem letztendlich nur wenige nachgeweint haben, dessen Reformierbarkeit nicht mehr überprüft werden konnte und mit dem angeblich auch die Idee von menschlicher Emanzipation außerhalb der kapitalistischen Vergesellschaftung verloren ging.
Eugen Ruges Familiengeschichte ist lang nicht so schlecht wie das gefeierte Buch „Der Turm“ von Uwe Tellkamp über eine andere Familie in der DDR. Es reicht aber bei Weitem nicht an die literarische, philosophische und analytische Qualität vieler Romane der DDR-Literatur heran, auch wenn sie wie Werner Bräunings Meisterwerk „Rummelplatz“ erst nach dem Untergang der DDR veröffentlicht werden konnten. Das Gesamtwerk von Volker Braun, „Der geteilte Himmel“ von Christa Wolf, einige Romane von Stefan Heym, sogar „Die Aula“ und vor allem „Der Aufenthalt“ des der DDR gegenüber eher unkritisch eingestellten Hermann Kant sind Gesellschaftsromane, in denen, wie kann es auch anders sein, auch Familien vorkommen, deren Mitglieder sich in schwierigen Zeiten sehr unterschiedlich verhalten. Die Gemeinsamkeit dieser Werke ist ihre literarische Qualität, bei Bräuning, Braun und Wolf auch ihre avantgardistische Formsprache und vor allem ihr gesellschaftlicher Anspruch. Dieser Anspruch ist auch bei wohlwollender Lektüre bei Ruge nicht auffindbar. Seine gesellschaftlichen Bezüge sind längst Mainstream, seine Weisheiten über die DDR kaum klüger als ein Pawlowscher Reflex. Es wird nichts mehr verhandelt, was noch nicht in den Feuilletons vorkam. Vielleicht war es der abgesegnete Blick lange nach dem Abgesang, der dafür sorgte, dass „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ zum erfolgreichsten deutschsprachigen Roman des Jahres 2011 wurde.
Eugen Ruge hat die unfreiwillige Karikatur eines deprimierenden Buches geschrieben mit zum Teil holzschnittartigen Figuren, die so ähnlich auch im Westen Deutschlands hätten leben können. Überhaupt scheint das Leben im Familienkontext Schicksal zu sein. Als hätte es gerade in der sozialistischen Ideologie nicht viele andere Vorschläge gegeben, die die Familie weit hinter sich ließen und andere Lebensformen skizzierten. Der feine Unterschied zu einer fiktiven Familie im Westen ist das Gewicht und der Einfluss staatlich verordneter Ideologie auf das Alltagsleben. Es geht um acht Personen, wovon einer nur erwähnt wird, aber selbst nicht mehr vorkommt, weil er in Workuta verstarb. Der Roman hat 20 Kapitel, hüpft, wie es heute so üblich ist, zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her, angefangen von 1952 bis 2001. Die Zeitpunkte werden aus den unterschiedlichen Perspektiven der sieben Hauptpersonen geschildert. Der Roman liest sich wie Popcorn, ist leicht und verständlich geschrieben und geht kein einziges Mal wirklich auf den geschichtsphilosophischen Hintergrund der DDR ein, den der Autor bewusst oder unbewusst entpolitisiert, auch weil er nicht mehr zwischen Stalinismus, Realsozialismus und der Idee einer menschlichen Emanzipation unterscheidet. Er entsorgt lieber das missratene Baby mit dem Badewasser.
Entpolitisierung der DDR-Geschichte
Das offensichtliche Erfolgsrezept liegt in der Entpolitisierung der DDR-Geschichte. Bereits die beiden „überzeugten Kommunisten“, die Großeltern Charlotte und Wilhelm, haben ein höchst instrumentelles Verhältnis zum neuen Staat, in den sie aufgrund ihrer antifaschistischen Aktivitäten vor und während der Naziherrschaft aus ihrem mexikanischen Exil zurückbeordert werden, um am Aufbau der DDR teilzuhaben. Wilhelm repräsentiert all das, was sich ein wohlmeinender Westdeutscher unter einem verbohrten Stalinisten vorstellt. So singt er dann auch noch an seinem 90. Geburtstag, am 1. Oktober 1989, völlig dement den Evergreen „Die Partei hat immer recht“, selbstverständlich ohne Stalin im Text zu streichen. Der Intelligenteren von beiden, seine Frau Charlotte, die sich eigentlich schon im mexikanischen Exil am liebsten von ihm getrennt hätte, bietet der neue Staat Aufstiegsmöglichkeiten. Mit nur vier Jahren Haushaltsschule wird sie Institutsleiterin in der Akademie der Wissenschaften und unterstützt mit einem Artikel im Neuen Deutschland die Restalinisierung in der Kulturpolitik während der Sechzigerjahre, der z. B. Werner Bräunings Manuskript „Der Rummelplatz“ zum Opfer fiel. Ob diese beiden Figuren jemals durch den Traum von Emanzipation beflügelt wurden, bevor sie sich selbst zu braven Parteisoldaten degradiert haben, erfährt der Leser nicht.
Die interessanteste Person des Romans, Kurt Umnitzer, Historiker der Arbeiterbewegung, dessen Werke für den Roman jedoch keine Rolle spielen, war im Gulag und dann in der Verbannung wegen einer brieflichen Kritik des Hitler-Stalin-Paktes. In der Verbannung verliebte er sich in die Russin Irina, die als Sanitäterin der Roten Armee gegen die Nazis im Krieg war. Kurt vertritt einen demokratischen Sozialismus, doch wird dies nur einmal kurz erwähnt, es geht ja schließlich um eine Familiengeschichte. Es steht geschrieben, dass sich Kurt in Irina verliebt hat, die beiden leben in der DDR die klassisch-bürgerliche Ehe mit der entsprechenden Arbeitsteilung und ertragen sich nur noch. Erst spät nimmt Irina eine Teilzeittätigkeit bei der DEFA an, eigentlich ist sie Hausfrau und hauptsächlich mit dem Ausbau ihres Hauses beschäftigt. Wäre Irina nicht Teil der ersten Armee gewesen, die ihre Sanitäter mit aufs Schlachtfeld schickte, hätte sie eine durchschnittliche westdeutsche, am Wirtschaftsaufschwung orientierte und frustrierte Hausfrau abgegeben. Ihr starker Alkoholkonsum verweist aber eher auf ihre russische Herkunft.
Bei der Familie Umnitzer verhält es sich wie beim Adel, die Nachfahren neigen zum Verfall, nicht nur was die Werte ihrer Vorfahren angeht, sondern auch im zwischenmenschlichen Umgang. Sascha, der Sohn von Irina und Kurt, gehört ein wenig zur Boheme, ohne dabei politisch aktiv zu sein, er heiratet schnell, zeugt ein Kind und geht dann mit einer anderen in den Westen. Die verlassene Melitta ist ein wenig bürgerbewegt und kirchennah, ihr und Saschas Sohn Markus hängt mit Hools herum und schafft es nach der Wende kaum, seine Lehre bei der Telekom zu absolvieren. Sascha ereilt eine seltene, aber lebensbedrohende Krankheit, weshalb er seinem inzwischen dement gewordenen Vater Kurt, den er hasst, Geld entwendet und nach Mexiko fährt, dort wo seine Großmutter einst im Exil war, um sein Leben abzuschließen. Dass alles umsonst war, sollen auch Kurts Erinnerungen belegen, die er erst nach der Wende – wenn kaum noch jemand die Erfahrungen eines deutschen Kommunisten im Gulag interessieren – schriftlich niederlegt. Die literarisch gelungenste Figur ist Irinas Mutter, Nadjeshda Iwanowna, die aus dem Ural zu ihrer Tochter in die DDR kam, wo sie nie Fuß gefasst hat.
Die Ideologiekritik wird vorausgesetzt in einem Einverständnis der potenziellen Leser. Leider bleibt auch sie ein uneingelöstes Versprechen. Kritik an der Einheitsfrontpolitik der KPD bzw. an ihrer Sozialfaschismusthese wird kurz am Rande erwähnt, ein Kollege von Kurt dafür aus der Partei ausgeschlossen, aber eigentlich ist sie kein Thema des Romans. Auch die Zeit im Lager, die Anatoli Rybakov und Wassili Grossman in ihrer Prosa so eindringlich beschreiben, wird nur angedeutet. Sozialistische Kritik am Stalinismus in der späteren DDR wird einmal kurz in Gestalt von Karl Irrwig erwähnt, Peter Ruben etwa und dessen Reformvorschläge aus den Achtzigerjahren finden keinen Eingang in Ruges Geschichte. Doch kann dem Autor nicht der Vorwurf gemacht werden, die Wende abzufeiern. Glücklich werden die Protagonisten danach auch nicht, doch ihre Probleme sind anderer Natur. Der DDR-Sozialismus endet jedenfalls für die Romanfamilie mit dem Mord an Wilhelm durch seine Frau Charlotte, die ihn vergiftet, weil sie ihn einfach nicht mehr erträgt. Wie der Rest der Familie den Realsozialismus, was immer das war.
Elfriede Müller
Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts. Roman einer Familie. 425 Seiten. Berlin: Rowohlt Verlag 2011. 19,95 Euro.