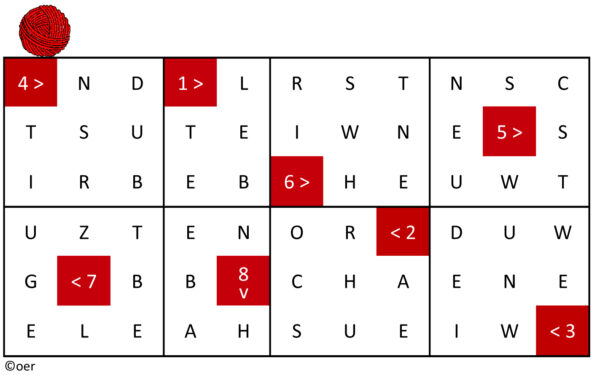„Ende der Demokratie“? – Neubeginn unserer Demokratie
Feststellungen über die Angst bundesdeutscher Politiker vor dem „Volk “
Beobachtungen Görlitz September 2022 – Juni 2023
Für gut dreißig Jahre meines Lebens bin ich in Bayern daheim gewesen. Seit September letzten Jahres wohne ich an der Neiße, in Görlitz. Freunde hatten mich vor meinem Umzug nach Sachsen gewarnt. Wegen der häufigen gewaltsamen Umtriebe dortiger Neo-Nazis. Wegen der Gefahren für die Demokratie durch die rechtsextreme AfD, die sich im Leben von Kommunen, Landkreisen und auf Landesebene politisch einnisten könnte. Wegen der Ossis mit ihrer DDR-Nostalgie. Und jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr.
Für mich, einen Deutschen des Jahrgangs 1938, der dank besonderer familiärer Zusammenhänge von Kindheit an weitgehend englisch geprägt wurde; der dank eines Studiums in Cambridge und der Ehe mit einer englischen Musikerin in London als Journalist und Verlagslektor die britische Demokratie aus der Nähe kennenlernte, als Verleger in der Schweiz und in Österreich später die Demokratie dort hautnah miterlebte und dank einer zweiten Ehe die Demokratie in Frankreich und Italien aus der Nähe wahrnehmen durfte – für mich sind die Erfahrungen, die ich in meiner neuen Heimat gemacht habe, zu einer überraschend neuartigen Lektion demokratischen Lernens geworden.
Ich habe wieder mal ganz von vorn anfangen müssen, nach dem Tod meiner Lebenspartnerin, als an ein Verbleiben, für mich allein, in dem isoliert gelegenen Anwesen im niederbayerischen Rottal nicht mehr zu denken und eine erschwingliche kleine Stadtwohnung im Umkreis nicht zu finden war. So bin ich mit 83 Jahren auf Görlitz gekommen, obwohl ich dort nicht eine Seele kannte. Als ein bis auf die Rente mittelloser, unbedeutender Fremdling bin ich – nach einem schweren Schlaganfall plus einer fast tödlich verlaufenen späteren zweiten Corona-Infektion – seit über zehn Monaten in zwei Krankenhäusern, in einer mehrwöchigen Kurzzeit-Pflege beim Arbeiter-Samariter-Bund und in täglicher Betreuung durch einen Mobilen Pflegedienst, mit immer noch behinderter Mobilität zur Rehabilitation auf Hilfe angewiesen und wesentlich auf die Gesellschaft von Pflegerinnen und armen kranken Alten beschränkt. Ich erwähne es nur zur Erklärung einer speziellen Erfahrung, die ich in Sachsen machen konnte – wohlgemerkt in meinem eigenen, persönlichen Erfahrungsraum: eine Erfahrung, die mein Verständnis der politischen Realitäten und der Demokratie in der Bundesrepublik von Grund auf verändert hat.

Vier Riesenüberraschungen
Das Gesundheitswesen ist hier im Osten bekanntlich um einiges schlechter ausgestattet als im Westen. Was meine medizinische Betreuung betrifft, so war sie – trotzdem – im städtischen Krankenhaus wie im privaten St. Carolus von Görlitz jedoch nicht weniger vorbildlich als im Klinikum Rottalmünster; und im Zuge meiner Entlassung war das sorgende Engagement der Sozialdienst-Leiterin im Städtischen geradezu singulär. Beim ASB blieb das Personal auch bei offenkundiger Überlastung und Unterbesetzung unermüdlich hilfsbereit. Der Mobile Pflege- und Hauswirtschaftsdienst zeigte eine Professionalität, eine Personalführung, ein Leistungs- und Verantwortungsbewusstsein, wie das meine pflegebedürftige Lebensgefährtin im Raum Passau/Bad Griesbach nicht erleben durfte. Ich habe dazu eine eigene Vergleichsmöglichkeit, weil ich vor meinem Wegzug aus Bayern einen ersten schweren Schlaganfall und meine erste Corona-Infektion überstehen musste.
Der nächste Grunde zum Staunen: Die Görlitzer Pflegerinnen und Pfleger erwiesen sich nicht bloß als anstellig, arbeitswillig, ungemein diszipliniert und fleißig, dazu als anpassungsfähig und flexibel. Sie sind, mit Kolleginnen und Kollegen drüben verglichen, gut ausgebildet, auf penible Weiterbildung bedacht und üben ihren Beruf gewissenhaft und sicher aus. Sie sind nicht bloß kompetent. Für sie stellen Kompetenz und Kollegialität allgemein einen Leitwert dar.
Eine dritte große Überraschung: Ich war noch nie, alles in allem, so lange dermaßen hilflos gewesen. Es fiel schwer, die Ohnmacht zu akzeptieren und um Hilfe zu bitten. Doch sie fanden für mich einen Weg, damit umzugehen. Sie vermittelten den Eindruck, es sei eine Selbstverständlichkeit zu helfen. Sie kamen mir zu Hilfe, bevor ich sie bitten konnte. Sie wussten, was ich brauchte, wenn ich selbst nicht mal ahnte, was mir abging. Mit dem, was sie für mich taten, gingen sie weit über das hinaus, was sie hätten tun müssen; und hätte mich dafür nicht erkenntlich zeigen können. Als selbstlos tätige Nächstenliebe habe ich es zunächst gedeutet, dann – mit einer Ausnahme, bei einer Zeugin Jehovas – allerdings keine Spur von christlichem Glauben entdeckt. Hier war man doch, so die gängige Meinung im Westen „gottlos“. Zudem galten „Ossis“ nicht als solidarisch denkende Demokraten. Woher rührten also die bemerkenswerte Freundlichkeit, Humanität, Bürgermoral?
Da war ich nun – von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Anteilnahme an dem deprimierenden Weltgeschehen; ohne Freunde; ohne meine geliebte Musik; unfähig zu lesen, weil ich monatelang kein Buch, keine Zeitschrift in der Hand halten konnte; und ich hätte es ja auch nicht vermocht, Tag und Nacht irgendwie Zazen zu praktizieren, um innere Ruhe und Frieden zu finden. Doch war ich keineswegs allein. Sondern mit zwei, drei, vier Menschen auf dem Zimmer, denen es oft schlechter als mir ging ging, die oft wirklich einsam waren: Unbekannte, meist einfache stille Männer, die freilich, wenn angesprochen, nach einiger Zeit von sich aus weitersprachen; die interessant wurden, wenn sie auf Interesse stießen. Anknüpfungspunkte gab es genug. Wann immer sie den Alarmknopf drücken mussten und eine Schwester nicht gleich verfügbar war; bei plötzlichen Notdienst war ein Mangel an Personal nicht selten. Das führte zu engerer Kommunikation mit Pflegerinnen und Pflegen. Ich gewann Vertrauen – als informeller „Springer“, „Notnagel“, „Händchenhalter“, „Brückenbauer“, als Mann im Hintergrund. Es war eine neue Rolle, auf die ich jedoch irgendwie vorbereitet war – ich hatte ja im Lauf meines Lebens in jeder Hinsicht „mehrsprachig“, „ökumenisch“, auf allen Ebenen „hinhören“ und „anreden“ gelernt. .
Im Kindesalter als Vollwaise mit unablässig wechselnden „Müttern“. Dann als interkonfessionell aufgewachsener Pietist. Als aktives Mitglied der Studentengruppe C.I.C.C.U. in Cambridge, die verwaiste freikirchliche Dorfgemeinden mit Laienpredigern versorgte. In London durch den Anglikaner John Stott, der die „frommen“ Evangelikalen zu sozialem Denken und Handeln lenkte. Später, als Katholik, durch die neuverstandenen „Exerzitien des“ Ignatius von Loyola und den amerikanischen Trappisten, Reformtheologen und Mystiker Thomas Merton, über den ich Zen entdeckte. Und zuletzt als Schüler und Freund des Schweizer Jesuiten Robert Hotz, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs seine Slawistik-Dozentur in St. Gallen aufgab, um, ein privates Hilfswerk für die Ärmsten der Armen in der Ukraine aufzubauen. Dafür ließ er, ein Abt mit Mitra der uniert-orthodoxen Kirche, sich sogar darauf ein, in Kiew zum Polizei-Obersten ernannt zu werden – um korrupten ukrainischen Grenzern Paroli bieten zu können. Rund zwei Millionen Franken hat Pater Hotz an jährlichen Spenden gesammelt. Damit alle medizinischen Hilfsgüter die Ukraine auch erreichten, fuhr er übrigens bei jedem LKW-Transport persönlich mit.
Und eines – die vierte große Überraschung – hatte ich bei meinen Gesprächen und Sondierungen in Görlitz schon gar nicht erwartet, nämlich dass mir bisher nicht ein Antisemit, nicht eine einzige Rassistin begegnet ist. Ebenso wenig: Neonazis und sonstige braune Extremisten, die es ja auch gibt, aber offenbar nicht in der üblicherweise berichteten Dichte, keinesfalls jedoch in ähnlich häufiger Auffälligkeit wie in Passau und Umgebung. Auch Fremdenfeindlichkeit habe ich in Görlitz bisher nicht bemerkt. Und: auf Verständnis für die AfD bin ich gestoßen; auf aktive und bekennende AfDler nicht. Warum machen die Medien sowie das Parteien-Establishment des Westens dann solch großes Geschrei über die AfD als Gefahr für die Demokratie in Sachsen – nicht aber in Bayern? Nur weil die CDU hier oder in Thüringen mit der AfD eine Koalition eingehen könnte, in München hingegen von Söder lautstark auf Distanz gehalten wird?

Berlin 1989/90: „Demokratie“ oder „Demokratur“?
Natürlich kann ich für meine Beobachtungen keine Meinungsstatistik mit vielleicht tausend oder mehr gelisteten Befragungen anführen. Auch wenn diese allerdings anonym und nur Blitzaufnahmen sind, ohne biographische Hinterfragungen, oft in tendenzieller Vorerwartung angespitzt; in ihrer meist flinken journalistischen Auswertung als pure Datenverarbeitung können sie eigentlich nicht als Recherche gelten. Dagegen stehen bei mir „ bloß“ (nachträglich geschätzte) Gespräche – rund fünfzig Mitpatienten, Männer und Frauen von fünfzig bis neunzig Jahren; dazu ein Personal von etwa zehn Pflegern und vierzig hochqualifizierte Schwestern und Alterspflegerinnen, Fach- und Hilfskräften, Azubis und Praktikantinnen zwischen sechzehn und siebzig Jahren. Wahrgenommen habe ich sie unter natürlichen Lebensumständen im Laufe von insgesamt zehn Monaten, in privaten oder gar intimen Situationen, in offener, vertraulicher Unterredung. Die Zeit des aktiven, oftmals sehr intensiven Kennenlernens hat im kürzesten Fall knapp drei Stunden, sonst mindestens ein bis drei Tage, beim Pflegepersonal alles in allem bis zu drei oder vier Wochen gedauert. Aus alledem können sich ganz andere Dimensionen und Grade des Wahrnehmens ergeben als bei heute üblichen journalistischen „Erhebungen“, Interviews und Reportagen.

Unfair. Denn im Grunde hatte er nicht mehr geschrieben, als in Details längst bekannt war. Er hat die im Mainstream unserer Medien gehegte Diskriminierung der Neu-Bundesbürger als DDR-nostalgische „Ossis“ konzentriert und ihr Ausmaß enthüllt. Allerdings nicht in Form des üblichen, abgehobenen, neutralisierten, quasi-akademischen Sachbuchs. Vielmehr in persönlicher Identifizierung mit den Opfern, die seit der Wiedervereinigung unter solcher diskriminierend falschen Etikettierung zu leiden haben. Er hat ihnen eine Stimme gegeben und damit den wunden Punkt, das Problem der Journalisten bloßgelegt: Journalisten schreiben über andere, die sie damit be- und verurteilen – was für sie auch ein Geschäft bedeutet, das sie selber einer (zumindest moralischen) Be- oder Verurteilung aussetzt Und eben das ist für sie inakzeptabel – sie, die andere kritisieren, stellen sich über Kritik von anderen. Sie halten sich für unanfechtbar. Und, wie es der Zufall wollte, hatte ich mich just um die Zeit des Traras um Dirk Oschmann ernsthaft mit diesem Problem zu befassen begonnen.
Außerdem bin ich von Profession zwar (freier) Journalist, nur war ich nach der Ankunft in Görlitz ja „berufsunfähig“. Was ich in Görlitz wahrnahm, habe ich privat erlebt. Ohne darüber schreiben zu wollen. Auf diese Idee hat mich erst Dirk Oschmann gebracht, in einer Art ungewollter Nötigung. Er wurde von deutschen Journalisten angegriffen wegen seines Buches „Der Osten: Eine Erfindung des Westens“. Weil sie sich von ihm angegriffen fühlten.
Ich war ja im (früheren) Hauptberuf literarischer Lektor und Verleger, und es war eine bedeutende literarische Publizistin jüngster Tage – Janet Malcom, eine als Kleinkind mit den Eltern vor den Nazis aus Tschechien geflüchtete Amerikanerin -, welche die Medienbranche mit folgender Aussage an die Decke trieb: „Jeder Journalist, der nicht zu dumm oder von sich selbst besoffen ist, um zu merken, wie es läuft, weiß, dass sein Tun moralisch angreifbar ist.“ (Diese Aussage gilt mittlerweile als Leitsatz der Ausbildung für Qualitätsjournalismus.) Zu solch einer fundamentalen Journalismus-Schelte hatte sie ihr Begriff von Literatur als einer beispielhaften Hochform menschlichen Wahrnehmens und Erkennens geführt. Insofern kann es kaum wundernehmen, dass ein Professor für Neuere Deutsche Literatur (in Leipzig), Autor des Buches „Der Osten: Eine Erfindung des Westens“ ist und ich für ihn Partei ergreifen musste. Und wenig später hat mir dann der Jahrestag des 17. Juni in Görlitz bewusst gemacht, dass die Angriffe auf Dirk Oschmann von einem anderen Problem ablenken, nämlich dem Problem der Bundesrepublik mit der Wiedervereinigung – ein Riesenproblem, das mit der laufenden Debatte um das „Ende der Demokratie“ verbunden ist.
Die bundesdeutsche Wende- und Wiedervereinigungs-Saga ist mir – nach zwölf Zwischenjahren im Ausland – wie eine B-Movie-Verfilmung des biblischen Gleichnisses vom reichen Erstgeborenen erschienen, der einen minder begabten, in schlechter Gesellschaft mitgelaufenen und bankrotten jüngeren Bruder aus seinem Schlamassel herausholt und unter großen finanziellen Opfern wieder flott und gesellschaftfähig macht. Ja, die DDR war ein Unrechtsstaat, der Gott sei Dank nicht mehr existiert. Ja, für seine Auf- und Ablösung hat die Bundesrepublik die Gesamtsumme von plus/ minus zwei Billionen Euro aufgebracht. Dass die Bundesrepublik/ der Westen diese beiden Fakten in ihrer hausgemachten Demokratie-Bilanzierung als Aktiva für sich positiviert hat gehört jedoch in ein Guinness Buch der Rekorde – von Fake News.
Die Beendigung des kommunistischen Unrechtsstaates ist ein demokratisches Binnenphänomen des Landes gewesen – eine Eigenleistung der Bevölkerung; Resultat einer friedlichen Revolution gegen das SED-Regime. Und die Bonner Hauptakteure des Einigungsprozesses mögen – angesichts der kaum erfassbaren Dimensionen und Herausforderungen des plötzlichen Zusammenbruchs der ideologischen, militärischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Systeme und Fronten des Kalten Krieges – Respekt verdienen: dafür, dass sie ein administrativ tragfähiges Einheitsgebälk mit funktionierenden Mechanismen politischen Handelns zu zimmern verstanden, zu dessen Errichtung Geld für sie kein Problem darzustellen schien. Mit einer demokratischen Aktion der Bundesrepublik aber hatte es eher nichts nichts zu tun.
Diese Demokratie im Osten war Folge eines Staatsvertrags: von Verhandlungen zwischen zwei Teilstaaten eines Volkes, deren einer sich finanziell wie strukturell am Ende und deshalb genötigt sah, auf die Bedingungen einzugehen, unter denen der andere ihm eine rettende Hand bot. Einer Bevölkerung, die das Joch des kommunistischen Unrechtsstaates abgeworfen hatte, wurde das Ordnungs-, das Wirtschaftssystem und das Recht einer fremden Demokratie übergestülpt, die unter gänzlich andersgearbeiteten Voraussetzungen, Ideen und Funktionszusammenhängen entstanden war. „Wäre es nicht richtig gewesen“, hat ein kleiner Beamter gefragt, „für das neue Gesamtdeutschland eine neue Verfassung ausarbeiten zu lassen, um die Interessen und Rechte beider Seiten zu berücksichtigen? Und darüber dann von beiden Seiten abstimmen zu lassen?“ (Das hatten sich ja auch, wie ich in Bayern hörte, gar nicht wenige Demokraten im Westen gewünscht.) „Weshalb haben Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble die Wiedervereinigung so fürchterlich schnell durchboxen müssen?“, bin ich gefragt worden. In Bayern. Jetzt wieder, in Sachsen. „Kohl und sein Spezi Schäuble haben die deutsche Einheit gebraucht. So. Genau. Vor den turnusmäßigen Wahlen Ende 89“, hat mir eine Passauer Lehrerin erzählt. „Sonst hätten sie doch“, sagte mir ein alter Görlitzer KfZ-Meister, „im Westen ihre Regierungs- und Parteiämter verloren.“ ,
„Es geht um die Glaubwürdigkeit politischer Parteien überhaupt“
Von einer Nostalgie für die Zeit des SED-Regimes habe ich während der letzten zehn Monate in Görlitz nichts zu spüren bekommen. Sehr viel jedoch von oft schweren Drangsalierungen und Härten für ihre Großeltern, Eltern, für sich selbst und oder ihre Kinder. Von Verfolgungen auch. Sie hatten sich, nicht selten mit wenig Geld und mit findigem Geschick, meist ohne Chancen auf ein Weiterkommen, mit der Mängelwirtschaft der DDR abgefunden, die bei niedrigem Lebensniveau und ratsamer Unauffälligkeit für eine hohe Sicherheit sorgte. Wirtschaftliche Existenzangst war ein eher seltenes Phänomen. „Diese Ruhe“ ging den Menschen nach der Wende rasch verloren und ist seit Beginn der geeinten Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung ein Stück der Erinnerung, das man schätzt und pflegt.
Die Demokratie aber ist von sukzessiven Ordnungs- und Hoffnungszusammenbrüchen nach dem Mauerfall überschattet. Darüber wird nur ungern und gewöhnlich erst gesprochen, wenn nach etwas längerem Miteinander-Vertraut-Werden eine gewisse Bereitschaft zu Offenheit und Risiko-Äußerungen angebahnt ist. Gegenüber Journalisten ist diese Scheu besonders groß. Mit dergleichen Herrschaften will man möglichst wenig zu tun haben – was den Zeitgenossen an den politischen Rändern natürlich eh Raum lässt, sich rasch in den Vordergrund zu spielen, um sich Gehör zu verschaffen. Das wahre Problem mit Demokratie in der DDR sind sie jedoch wohl kaum. Das echte große (problem of democracy in the ex-DDR) ist das Herkommen der heutigen Demokratie im Osten aus der gestrigen bundesrepublikanischen Demokratie der 1980er und 1990er Jahre, aus dem obrigkeitlich korrupt-demokratischen Parteiregime Helmut Kohls und Wolfgang Schäubles, mit der nie aufgeklärten Spendenaffäre Kohls, im Jahr 1998. Dass es damals überhaupt ein Ende fand und Kohl als Ehrenvorsitzender abtreten musste, ist übrigens auch keinem innerparteilich demokratischen Selbstreinigungsprozess der CDU zu danken. Es ist sozusagen Folge eines demokratischen Aufstands – von Seiten eines „Demokratie-Rück-Imports“ aus dem deutschen Osten mit dem Namen Angela Merkel. Sie zwang Kohl zum Rücktritt, weil sie als einziges CDU-Führungsmitglied den Mut besaß, den Möchtegern-Autokraten Kohl öffentlich dazu aufzufordern, und zwar mit folgender Erklärung in der F.A.Z: „Die von Kohl eingeräumten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt. Es geht um die Glaubwürdigkeit Kohls, es geht um die Glaubwürdigkeit der CDU, es geht um die Glaubwürdigkeit politischer Parteien überhaupt.“
So hat Angelas Merkel die CDU und die Demokratie damals gerettet. In ihrer 16jährigen Kanzlerschaft hat sie in der Bundesrepublik Ruhe und Stabilitätbewahrt, ohne notwendige Reformen zur Stabilisierung der Demokratike herbeizuführen, so dass die repräsentative Demokratie unseres Landes erneut und in noch größerer Gefahr ist, so dass nun sogar vom „Ende der Demokratie“ die Rede ist.
An dieser Stelle möchte ich nun Gertrude Lübbe-Wolff vorstellen – als eine der herausragenden Frauen unseres Landes. Sie war die erste Juristin, die meines Wissens in einer Kommunalverwaltung die Umsetzung von Umweltgesetzen leitete; die als Wissenschaftlerin und als Bundesverfassungsrichterin die Umweltgesetzgebung und die EU zu ihrem Thema machte; eine von bloß sieben Juristinnen (unter 398 Wissenschaftlern), die mit dem seit 1986 vergebenen Leibniz-Preis – dem mit bis 2.5 Millionen Euro höchstdotierten deutschen Forschungsförderpreis – bedacht wurden; die als zweite Frau und als Rechtsphilosophin den Stuttgarter Hegel-Preis erhielt. Frau Lübbe-Wolff hat einen scharfen Blick für weite, tiefgründige Zusammenhänge. Unter den Denkern, die sie prägten, kommt der große Hegel allerdings erst an dritter Stelle. Bedeutender ist für sie ihr Ehemann, ein Ethiker; und ihr Vater. Hermann Lübbe hat als Staatssekretär der Regierung von Nordrhein-Westfalen Politik gemacht und als Professor an der Universität Zürich realitätsbezogen Politische Theorie gelehrt. Durch ihn lernte seine Tochter die direkte Demokratie der Schweiz kennen. Dank ihm wurde sie auf die Bedeutung dieser Art von Demokratie als Korrektiv für heutige repräsentative Demokratien aufmerksam. (Was übrigens auch für mich selbst gilt: Wir sind in Einsiedeln, im Kanton Schwyz Nachbarn und Freunde geworden.) Nun hat Grete Lübbe-Wolff also die wohl gewichtigste Neuerscheinung des Jahres zur dringlichsten Reform unseres Landes vorgelegt. Sie schließt mit dem Satz: „Dieses Potential“ einer direkten Demokratie „ungenutzt zu lassen, war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie so riskant wie heute.“

Auch ihrem 2023 erschienen Buch und ihr Buch „Demophobie: Muss man die direkte Demokratie fürchten?“ (Klostermann RoteReihe) ist der (übliche) Vorwurf gemacht worden, es hätte positiver ausfallen müssen. Doch damit beginnt eben seine Brillanz: dass es all die ollen Kamellen, die allerorten immer wieder aufgetischt werden, die vielen „grundsätzlichen Vorbehalte“ gegen direktdemokratische Verfahren fein säuberlich aufsammelt und picobello serviert – um sie nämlich ein für allemal abzuservieren. Es macht unbändig Spaß, die eleganten spitzen Florettstöße nachzuvollziehen, mit denen sie einen althergebrachten Humbug nach dem andern aussticht. Als lächerliche „ideologische Rückstände“ des Hasses längst zu Staub und Asche zerfallener Despoten und Tyrannen auf „das Volk“, aus Angst, es könne die unerträgliche Last abwerfen, die sie ihm aufgebürdet hatten. (Eine Gaudi, den Zitterich hinter der Maske von Parteibossen oder ministeriellen Talk Show-Größen zu erspüren.) Oder es handelt sich um abgestandene Verallgemeinerungen, wie sie eins gegen Demokratie überhaupt aufgefahren wurden. Um Pauschalurteile, die von irgendeinem missglücktem Falschmanöver wie dem britischen abgeführt werden. Um die abergläubische Litanei, in einer Direktdemokratie hätten eigene politische Desiderate noch weniger Chancen. Und immer wieder ein prinzipieller Denkfehler – indem das allerhöchste Ideal repräsentativer liberaler Demokratie stets mit irgendeinem halbwegs erfolgreichen direkt-demokratischen Akt aus den Niederungen einer spezifischen Realität verglichen wird. Welch ein intellektuelles Vergnügen, dergleichen böhmische Dörfer vorgeführt zu sehen.
Es löst freilich auch unheimliche Gefühlsregungen, Abscheu und Wut gegen Pappenstier unserer Demokratie aus. Sie verraten die Ohnmacht, „die politische Frustration“ in Anbetracht dessen, was Bürgern „unter den gegenwärtigen Bedingungen der repräsentativen Demokratie fehlt“ – nämlich „die Möglichkeit, ihren politischen Präferenzen thematisch zielgenau Ausdruck zu verleihen“, wie Frau Professor Lübbe-Wolff schreibt.
Es sind „Funktionsdefizite“ der real existierenden Demokratie, unter denen wir leiden. Und „sie sind insbesondere in den Demokratiedefiziten der auswärtigen Politik begründet“. Das ist der nämlich der Bereich, „aus dem sich, was die handfesten Existenzbedingungen angeht, die heftigsten Unzufriedenheiten mit dem gegenwärtigen System der repräsentativdemokratischen Politik speisen: die Globalisierung, einschließlich Europäisierung. Gerade auf diesem Gebiet neigt repräsentativdemokratische Politik dazu, sich von den Wünschen der Bürger in besonders auffälliger Weise abzukoppeln. Das hängt mit der besonderen Exekutivlastigkeit der auswärtigen Politik zusammen.“
„Direkte Demokratie“, erklärt Gertrude Lübbe-Wolff, „kann das ändern. Wenn die Bürger sich in den bedeutenden Fragen der nationalen Europapolitik und sonstigen Fragen der internationalen Politik unmittelbar äußern könnten, würde schon die repräsentativdemokratische Politik sich von vornherein ganz anders aufstellen und sich enger an den Präferenzen der Bürger orientieren müssen. Der Prozess der weltwirtschaftlichen und europapolitischen Integration würde sich dann zweifellos zäher gestalten. Das entspräche aber auch genau dem politischen Bedarf.“
Die Menschen, die ich seit Anfang September letzten Jahres in Görlitz kennenlernen durfte, sind keinen Deut weniger klug, lebensfähig und tüchtig als die in Niederbayern, wo ich seit 1995 gelebt habe. Und ihr erstaunlicher Bürgersinn hat, wie ich mit Erstaunen erlebte, tiefe Wurzeln, die in Familien gepflegt wurden, als der SED-Staat alles Gedenken daran zu unterdrücken suchte und auch, als die Bundesrepublik den „Tag des 17. Juni“ abschaffte, um den nationalstaatlichen „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober zu feiern – in wachen Erinnerungen an den 17. Juni 1953, als die Görlitzer ein Zentrum eines Volksaufstandes gegen das SED-Regime wurden. Und sie haben sich mir gegenüber insgesamt kein bisschen dümmer und unfähiger und illoyaler erwiesen als die Parteien und Minister der Koalition in Berlin einschließlich der CDU, inklusive eines prominenten Regierungspolitikers der Grünen, der vor kurzem erklärt haben soll: „Ich kenne kein Volk“ – wie die Bayern und ein großer Freundes- und Bekanntenkreis von arm bis reich, Links bis Rechts in der ganzen Bundesrepublik, und viele, die angeblich die AfD wählen (aber keine Björn Hockes wollen) und für die Freien Wähler sind, die in Opposition zu einer selbststaatsherrlichen CSU gingen und unter dem gern bayerisch-deppert und folkloristischen scheinenden Demagogie-Künstler Hubert Aiwanger heute mit der CSU regieren und es gegen Berlin tun.
Gerhard Beckmann
Literatur:
Dirk Oschmann: Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung. Ullstein Verlag, Berlin 2023. Hardcover, 224 Seiten, 19,99 Euro.
Gertrude Lübbe-Wolff: Demophobie. Muss man die direkte Demokratie fürchten? Klostermann Rote Reihe Band 151. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt 2023. 212 Seiten, 24,80 Euro.
Gerhard Beckmann ist einer der profiliertesten Menschen der deutschen Verlagsszene. Seine Texte bei uns hier.