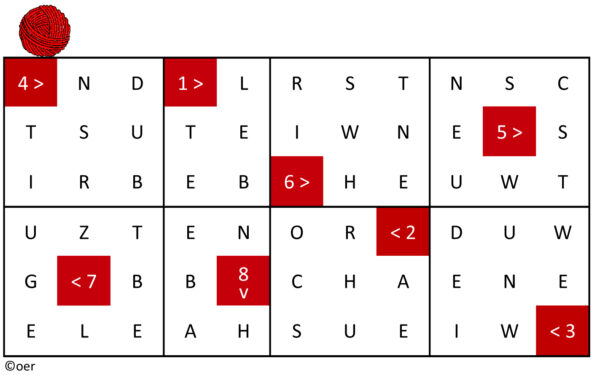Die Seismographen – Agenten und Spione heute
von Stefan May
Habent fata sua und so … Dieser Text basiert auf einem Radioskript, das nur in sehr reduzierter Form vom ORF realisiert wurde. Wir präsentieren Ihnen hier eine Prosafassung des Projektes, gespickt mit vielen O-Zitaten von Martin Maurer, Andreas Pflüger, Yassin Musharbash, Thomas Wörtche und andere mehr.
„Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht“, hatte Angela Merkel vor einiger Zeit gesagt. Geht nicht, gibt´s nicht. Schon gar nicht in der Spionage. Auch wenn die deutsche Bundeskanzlerin angesichts amerikanischer Maulwurfsarbeit das noch so kategorisch ausschließen will. Da ging immer alles, solange es zum gewünschten Ziel führte. Und das ist schon sehr lange so.
„Die Spionage ist entweder das älteste oder das zweitälteste Gewerbe. So einfach ist es.“ Das sagt der österreichische Historiker und Geheimdienstspezialist Siegfried Beer. Und darum wird diese Branche auch schon lange von der Literatur widergespiegelt. Dort heißen deren Vertreter James Bond oder Smiley, Figuren, deren Milieu Gänsehaut und Kribbeln hervorrufen kann. Vermittelt es doch dem unbescholtenen Bürger das sichere Insel-Gefühl, auf der Lesecouch nicht hineingezogen werden zu können.
Er entfernte sich mit raschen Schritten. Er achtete nicht darauf, ob ihm jemand folgte, kümmerte sich auch nicht mehr um den Schatten. Aber als er an die Straßenecke kam, wandte er sich zufällig um, und da stand, eng an die Mauer gepreßt, um nicht bemerkt zu werden, eine stämmige, untersetzte Gestalt.
 Im Roman aus dem Nachkriegs-Wien „Der dritte Mann“ bedient Graham Greene all die Klischees, die man mit Geheimdienstarbeit in Zusammenhang bringt: Schlapphut, Mantel mit hochgeschlagenem Kragen, Nebel, nächtliche Straßenecken, Verfolgungsjagd im Kanalsystem. Obwohl „Der dritte Mann“ genau genommen kein Buch über Spionage, sondern eine Kriminalgeschichte ist. Graham Greene hat aber auch einen echten Agentenroman geschrieben: „Unser Mann in Havanna“. Dieser Mann ist der liebenswert-arglose Staubsauger-Vertreter Jim Wormold:
Im Roman aus dem Nachkriegs-Wien „Der dritte Mann“ bedient Graham Greene all die Klischees, die man mit Geheimdienstarbeit in Zusammenhang bringt: Schlapphut, Mantel mit hochgeschlagenem Kragen, Nebel, nächtliche Straßenecken, Verfolgungsjagd im Kanalsystem. Obwohl „Der dritte Mann“ genau genommen kein Buch über Spionage, sondern eine Kriminalgeschichte ist. Graham Greene hat aber auch einen echten Agentenroman geschrieben: „Unser Mann in Havanna“. Dieser Mann ist der liebenswert-arglose Staubsauger-Vertreter Jim Wormold:
Allmählich lernte Wormold die Vorsicht und die Tricks in seinem unwirklichen Gewerbe. Es war nur ein langer Schritt von einem Balkon zum anderen. Er schaute dabei nicht nach unten. Die Vorhänge waren nicht ganz zugezogen. Er spähte durch den Spalt.
 „Unser Mann in Havanna“ ist ein Gute-Laune-Buch, humorvoll und leichthin. Doch so wie da beschrieben und teilweise karikiert funktioniert Spionage heute nicht mehr. Allerdings auch nicht, wie es die aktuellen James Bond-Filme vorgaukeln. Geheimdienstarbeit hat sich verändert, verlagert in Büros und Computer, wie Nachrichten der jüngeren Vergangenheit bestätigen.
„Unser Mann in Havanna“ ist ein Gute-Laune-Buch, humorvoll und leichthin. Doch so wie da beschrieben und teilweise karikiert funktioniert Spionage heute nicht mehr. Allerdings auch nicht, wie es die aktuellen James Bond-Filme vorgaukeln. Geheimdienstarbeit hat sich verändert, verlagert in Büros und Computer, wie Nachrichten der jüngeren Vergangenheit bestätigen.
Die Quelle hinter den jüngsten Enthüllungen über die Internet-Überwachung durch den US-Geheimdienst hat die Anonymität aufgegeben. Die britische Zeitung „Guardian“ enthüllte am Sonntagabend, dass dahinter der 29-Jährige Techniker Edward Snowdensteckt. Er sei die vergangenen vier Jahre als Mitarbeiter anderer Unternehmen in dem US-Geheimdienst NSA tätig gewesen. Die Identität werde …
… hat der britische Außenminister Boris Johnson dem Kreml eine Einmischung in europäische Angelegenheiten mit Hilfe von Cyberattacken vorgeworfen. Großbritannien werde sich notfalls mit gleichen Mitteln zu wehren wissen, so Johnson. Die Äußerungen sorgten …
… in Italien ist die Webseite der Demokratischen Partei um Ex-Premier Matteo Renzi laut Medienberichten von Dienstag ins Visier von Hackerngeraten. Diese veröffentlichten im Internet eine Liste mit Namen, Adressen und Telefonnummern von 2.652 Personen, darunter…
… fordern ein Cyberabwehrzentrum beim Bundeskriminalamt. Außerdem sollen die GeheimdiensteVorratsdatenspeicherung nutzen können. Nach Informationen der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen…
Das Profil von Geheimdienstarbeit hat sich verändert. Ist auch die aktuelle Spionageliteratur eine andere geworden? Die Explosion ungeahnter technischer Möglichkeiten hat es der Kunst schwerer gemacht, Agentengeschichten spannend umzusetzen, gibt Thomas Wörtche zu, der vielleicht profundeste Kenner von Kriminal- und Thriller-Literatur im deutschsprachigen Raum:
„Das mit der Cyberkriminalität ist natürlich ein bisschen schwierig in Romanen zu erzählen. Ich kenne einen deutschen Autor, Martin Burkhardt, der das mit „Score“ gut gemacht hat. Es gibt auch andere, sehr gelungene Versuche, von James Grady etwa. Allerdings beschreibt der keine Cybervorgänge, sondern deren Auswirkungen. Da kann man jetzt natürlich streiten, inwieweit es ästhetische Möglichkeiten gibt, lange Bildschirmausschnitte mit rennenden Zahlenkolonnen abzubilden. Das kann der Film möglicher weise besser.“
Dem widerspricht der Autor Martin Maurer nicht wesentlich:
„Als Drehbuchautor kann ich sagen, dass das immer ganz schwierig ist, denn man kann das ganz schwer versinnlichen. Der Film braucht eben noch die Bilder, da gibt es dann auch ganz interessante Lösungen. Aber diesen unsinnlichen Raum zu beschreiben, das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Und da habe ich auch noch nicht so spannende Lösungen.“
Es scheint, als hätte Spionage als Material für Literatur ausgedient. Wirtschaftsspionage mittels Computertastatur erzeugt keine Spannung, Geheimdienste, die im Darknet forschen, geben keine prickelnde Romanvorlage ab. Ist das Genre tot?
Rainer Rupp ist vom Fach, er gilt als einer der größten Spione des 20. Jahrhunderts und hat schon immer gerne Agentenliteratur gelesen. Die DDR führte ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter unter dem Decknamen Topas. Jahrelang hatte er insgesamt 1046 Dokumente des Nato-Hauptquartiers in Brüssel an die ostdeutsche Staatssicherheit weitergeleitet. Dafür musste er nach der Wende für acht Jahre ins Gefängnis.
„Die Spionageliteratur war schon immer ein bisschen auf Abenteuerliches, auf James Bond-Geschichten fixiert“, sagt Rupp. „Es gab aber auch diese andere Literatur, von Le Carré, der ja selbst, wenn auch nur kurze Erfahrung im Milieu gesammelt hat. Das sind Bücher, die viel subtiler sind und trotzdem an Spannung nicht nachlassen. So etwas gibt es heute, glaube ich, nicht. In den modernen Werken spielen High Tech oder Gewalt oder nur noch Gewalt und Super-Super-Menschen, Navy Seals oder solche Leute, die dann, wie es in der CIA heißt, die nassen Sachen machen, also wo Blut fließt.“
 Weniger düster sieht der Schriftsteller Andreas Pflüger die Entwicklung. Er hat 2004 einen Thriller über eine Spezialeinheit des Bundeskriminalamts gegen die internationale Waffen- und Drogenmafia unter dem Titel „Operation Rubikon“ geschrieben. Das Buch wurde 2016 neu aufgelegt. Abseits des veränderten Erscheinungsbildes der Spionagebranche sieht Pflüger Konstanten in dieser Literatursparte.
Weniger düster sieht der Schriftsteller Andreas Pflüger die Entwicklung. Er hat 2004 einen Thriller über eine Spezialeinheit des Bundeskriminalamts gegen die internationale Waffen- und Drogenmafia unter dem Titel „Operation Rubikon“ geschrieben. Das Buch wurde 2016 neu aufgelegt. Abseits des veränderten Erscheinungsbildes der Spionagebranche sieht Pflüger Konstanten in dieser Literatursparte.
„Ich persönlich glaube, dass das Genre überhaupt nicht tot ist, weil letztendlich ein guter Roman immer von etwas anderem handeln sollte, als von einem möglichst komplizierten und vielleicht auch sehr wenig greifbaren Überbau. Das sind keine spannenden Bücher, die sich daraus ergeben. Computerkriminalität, das ist zum Beispiel ein riesiges Thema in der Realität. Ich persönlich halte es aber für ziemlich untauglich für einen guten Thriller. Gute Geschichten sind Geschichten, die ohne einen riesigen Überbau auskommen und sich eigentlich immer mit dem Wesentlichen beschäftigen. Und was ist das Wesentliche? Das sind die ewig gültigen Themen Angst, Schuld, Liebe, Hass, Verrat, Demut, Sühne. Daraus können Sie ein gutes Buch machen.“
Einst wie jetzt. Auch wenn die Folie, auf der diese ewig gültigen Themen verhandelt werden, ihre Zusammensetzung und ihre Farbe gewechselt hat. Für diese einschneidende Veränderung gibt es sogar ein Datum: Den Mauerfall 1989, das Ende des Kalten Krieges. Andreas Pflüger vermeidet es allerdings, von Agenten-Romanen zu sprechen. So wie er fasst auch der Experte Thomas Wörtche das Genre weiter und unter dem Begriff Polit-Thriller zusammen.
„Die These ist oft geäußert worden, dass nach dem Ende des Kalten Krieges der Polit-Thriller sozusagen Out of Order war. Was nicht stimmt, denn der Kalte Krieg hat sich auf vielen Ebenen perpetuiert. Der ist da, die Blöcke sind noch da. Das wird jetzt klar in den neuen Machtkonstellationen: USA, in China, in Russland – einem Machtdreieck.“
Für Wörtche gibt es mehrere Möglichkeiten der Darstellung:
„Man kann das so machen, wie es D.B. Blettenberg, ein ausgezeichneter deutscher Autor, der auch immer Politthriller geschrieben hat, in „Berlin, Fidschitown“ beschrieben hat. Er erzählt, und das stimmt, das ist realitätstüchtig, dass der Vietnamkrieg hier zwischen Gangs aus Südvietnam oder Nordvietnam fröhlich weitergeht, indem sie sich im Berliner Underground bekriegen. Also, das ist noch lange nicht erledigt. Und all die Bücher, die sich mit Süd- oder Mittelamerika beschäftigen, mit Nicaragua, mit Honduras, mit all den CIA-Angriffen: das geht ja auch weiter. Die Contras-Situation ist nicht bereinigt. Kolumbien ist jetzt nicht drogenfrei, weil die DEA dort aufgeräumt hat. Das sieht man in immer neuen Narrativen.“
 Nach dem Ende des klassischen Ost-West-Konflikts hielt der Lauf der Geschichte unvermittelt neuen Stoff für Spionage-Schriftsteller bereit: Den Terrorismus. Yassin Musharbash ist Redakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“. 2011 brachte er den Thriller „Radikal“ über einen Terroranschlag im Berliner Regierungsviertel heraus. 2017 erschien von ihm „Jenseits“ über einen deutschen Dschihadisten.
Nach dem Ende des klassischen Ost-West-Konflikts hielt der Lauf der Geschichte unvermittelt neuen Stoff für Spionage-Schriftsteller bereit: Den Terrorismus. Yassin Musharbash ist Redakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“. 2011 brachte er den Thriller „Radikal“ über einen Terroranschlag im Berliner Regierungsviertel heraus. 2017 erschien von ihm „Jenseits“ über einen deutschen Dschihadisten.
„Ich glaube, Terror ist der neue Kalte Krieg in der Spannungsliteratur“, sagt Musharbash. „Wenn man über Terrorbekämpfung schreibt, schreibt man irgendwann über Spione.“
Und auch der Autor Andreas Pflüger meint, dass sich nach dem Ende des Kalten Krieges Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends und dem Anschlag auf das World Trade Center in New York 2001 eine thematische Verschiebung in der Agentenliteratur vollzogen hat.
„Jetzt war das ganz große neue Thema Terrorismus. Und das ist vermutlich so geblieben in den letzten 15 Jahren. Die Genreromane, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, handeln, glaube ich, mittlerweile vor allem von den Folgen. Und zwar nicht von den unmittelbaren Folgen, sondern von den mittelbaren Folgen dieses singulären Ereignisses. Nämlich von dem Wahnsinn, der sich in den Diensten seit den Ereignissen ausbreitet, also dieses krebsartige Wuchern von immer neuen Behörden, immer neuen Geheimdiensten, deren Mitglieder schon gar nicht mehr so genau wissen für wen sie eigentlich genau arbeiten, woran sie eigentlich arbeiten. Jeder bespitzelt jeden. Es ist so ein unterschwelliges Gefühl, dass das niemand mehr kontrolliert. Das ist eine Befindlichkeit, die, ich glaube, auch sehr viele Leser haben.“
Gerade deshalb hält sich aber Pflügers Kollege Martin Maurer auf Distanz zum klassischen Spionagethriller.
„Ich habe mit dem Personal des Agenten-Romans immer eher Schwierigkeiten gehabt, etwa James Bond: Ich gucke die Filme dann zwar gerne, aber das war mir persönlich immer zu weit weg von der Realität, und ich glaube, dass das im Moment eher Figuren sind, die schwierig auch auf für den Autor zu handhaben sind. Weil ich glaube, dass dieses sich fest auf eine Seite Stellen, möglichst auf die gute Seite Stellen, auf die des Helden, dass das inzwischen wirklich schwierig geworden ist zu erzählen.“
 Maurers Roman von 2011 heißt „Terror“. Jener Bedrängnis, sich auf eine Seite stellen zu müssen, entkommt er dadurch, dass er seinen Helden nicht im Milieu ansiedelt. Dieser ist nämlich ein Kameramann aus Berlin, der zufällig in Italien auf ein Terrornetzwerk stößt. Es geht um Geheimarmeen in Europa, die von der Nato koordiniert werden. Gladio hieß die Organisation in Italien, doch die Verbindungen reichen bis nach Deutschland. Auch diesen Roman prägen Unsicherheit, die Auflösung bisher vertraut gewesener Gewissheiten, die Doppelgesichtigkeit staatlicher Autorität.
Maurers Roman von 2011 heißt „Terror“. Jener Bedrängnis, sich auf eine Seite stellen zu müssen, entkommt er dadurch, dass er seinen Helden nicht im Milieu ansiedelt. Dieser ist nämlich ein Kameramann aus Berlin, der zufällig in Italien auf ein Terrornetzwerk stößt. Es geht um Geheimarmeen in Europa, die von der Nato koordiniert werden. Gladio hieß die Organisation in Italien, doch die Verbindungen reichen bis nach Deutschland. Auch diesen Roman prägen Unsicherheit, die Auflösung bisher vertraut gewesener Gewissheiten, die Doppelgesichtigkeit staatlicher Autorität.
„Für mich ist das ein ganz klares Zeichen“, sagt Maurer über sein Romanthema. „Ich glaube, man kann über Geheimdienste einfach nicht mehr auf die gewohnte Weise erzählen, weil man gar nicht mehr so richtig weiß, auf welcher Seite stehen sie denn nun, und hat man es mit den Guten zu tun, hat man es mit den Bösen zu tun. Und eine Figur, die ohne das zu hinterfragen, für einen Geheimdienst wo immer auf der Welt unterwegs ist, kann sehr interessant sein, aber das ist jetzt nichts, was mich persönlich interessieren würde. Und ich glaube auch nichts, was für die Zeit, in der wir im Moment leben, charakteristisch ist.“
Diese generelle Unsicherheit, die von den Autoren wahrgenommen wird, ist aber gerade das Hauptthema des US-amerikanischen Autors James Grady.
Alles löst sich in Dampf auf. Kein Name, kein Hauptsitz, keine Ausrüstung, keine Ausweise, keine Website oder E-Mail-Adressen, keine Datenketten, kein Ablaufdiagramm, weil es keine Organisation gibt, kein Budget, keine Erwähnung irgendwo. Kein Geheimniskasten. Keine Ehre. Keine Schuld. Keine Existenz, kein Personal. Vielleicht sieben der Politikoberen wissen Bescheid.
 James Grady nimmt eine aktuelle Grundstimmung der Gesellschaft auf. In seinem 2016 auf Deutsch erschienenen Thriller „Die letzten Tage des Condor“ beschreibt er das Verschwimmen von bisher als zuverlässig Geglaubtem, beschreibt, wie Gut und Böse ihre Positionen, aber nicht ihre Jobs tauschen, beschreibt die Angst, weil jene, die beschützen sollen, zur Bedrohung geworden sind. Bereits 1974 hatte James Grady den Bestseller „Die sechs Tage des Condor“ über einen CIA-Agenten mit dem Codenamen Condor geschrieben. 40 Jahre später lässt er nun seinen Agenten erneut auftreten, in einer allgemeinen Atmosphäre der Unsicherheit, in der dieser selbst nicht weiß, wer ihn jagt und und vor allem nicht, warum.
James Grady nimmt eine aktuelle Grundstimmung der Gesellschaft auf. In seinem 2016 auf Deutsch erschienenen Thriller „Die letzten Tage des Condor“ beschreibt er das Verschwimmen von bisher als zuverlässig Geglaubtem, beschreibt, wie Gut und Böse ihre Positionen, aber nicht ihre Jobs tauschen, beschreibt die Angst, weil jene, die beschützen sollen, zur Bedrohung geworden sind. Bereits 1974 hatte James Grady den Bestseller „Die sechs Tage des Condor“ über einen CIA-Agenten mit dem Codenamen Condor geschrieben. 40 Jahre später lässt er nun seinen Agenten erneut auftreten, in einer allgemeinen Atmosphäre der Unsicherheit, in der dieser selbst nicht weiß, wer ihn jagt und und vor allem nicht, warum.
Nach den Worten des Thriller-Experten Wörtche hat Grady mit dem aktuellen Roman ein Meilensteinbuch zum Thema Dauerüberwachung geschrieben. „Er hat das dann sozusagen schon fast bis zur Karikatur, also bis zur totalen kafkaesken Ungewissheit vorangetrieben. Also, das finde ich im Moment das literarisch Avancierteste, was da passiert ist, was man damit machen kann.“
Faye blieb vor der Betonwand in der Kehre zwischen dem vierten und ihrem fünften Stock stehen. Nahm ihr Handy, um sich mit dem Computer in ihrer Wohnung zu verbinden, checkte die Aufzeichnungen ihrer Computerkamera, die sie mit den Bewegungsmeldern verbunden hatte, die auf ihre Eingangstür und die Glasschiebetür, die vom Wohnzimmer zum Balkon ihres Zwei-Zimmer-Appartements führte, ausgerichtet waren: KEINE AKTIVITÄT. Die Computer-Kamera zeigte ihr auf dem Handydisplay die Innenseite ihrer Eingangstür, und dass das verdunkelte Wohnzimmer frei von Eindringlingen war. Sie ging zu ihrer Wohnung. Glitt hinein. Alles war ruhig. Verdunkelt.
Kommt es zu Verfolgung und Schusswechsel, etwa in einer Washingtoner U-Bahn-Station, überzeichnet Grady das wie ein nahezu surreales Ballett.
Fayes Waffe dröhnte auf der Rolltreppe neben ihm. Während sie rückwärts die Stufen der aufwärtsfahrenden Rolltreppe herablief. Vor Condor lag ein schwarzer Mann in einem braunen Ledermantel mit einem dunklen Fleck an der linken Schulter auf der Rolltreppe. Sie sprang über die orangefarbenen Drehkreuze, wirbelte herum, um ihren Rückzug zu decken, wo die abwärtsfahrenden Treppen eine zusammengesunkene Madonna auf einem bewusstlosen schwarzen Mann abluden.
Paranoia
Nicht nur hat der Terrorismus Paranoia erzeugt, Angst vor allem und jedem verstärkt und Misstrauen geschürt. Auch die zunehmend globalisierte Welt verlangt von den Autoren, dass sie ihre Geschichten oft an sehr unterschiedlichen Schauplätzen spielen lassen. Was früher mitunter als Kunstgriff verwendet wurde, um drohender Monotonie der Handlung zu entgehen, ist heute zum Erfordernis für einen glaubhaften Plot aus dem Agentenmilieu geworden.
Ein Beispiel dafür sind die Romane von Andreas Pflüger.
„In einer solchen Welt müssen Sie eine Geschichte auch entsprechend breit aufstellen, wenn Sie sich in diesem Genre bewegen wollen. Es hängt alles mit allem zusammen. Ich habe das jetzt in dem neuen Buch, „Niemals“, auch gemacht. Es spielt zu einem großen Teil in Marokko, in Marrakesch in der Wüste, in Rom, in Avignon, in Schweden, weil es auch in diesem Buch nicht zuletzt um den internationalen Terrorismus geht. Es spielt auch in England. Das sind nämlich Global Player. Und wenn Sie es mit Global Playern zu tun haben, dann tun Sie als Autor nicht gut daran, diese Geschichte in Kassel anzusiedeln.“
 Dieses jüngste Buch von Andreas Pflüger, ist der zweite Band einer Trilogie, in der eine blinde Polizistin als Hauptakteurin gegen gefährlichste Verbrecher anzukämpfen hat. „Endgültig“ heißt der erste Band, „Niemals“ der zweite. Jenny Aaron ist Mitglied einer fiktiven deutschen Spezialeinheit, die in besonders heiklen Fällen im In- und Ausland eigesetzt wird, um mit ihrem perfekt geschulten Personal präzise Operationen gegen Verbrecher und deren Organisationen durchzuführen. Und so wirkt es nicht aufgesetzt, sondern folgerichtig, dass Jenny Aaron sich auch auf dem berühmten, ebenso weiten wie bevölkerten Platz Djemaa el Fna in Marrakesch zurechtzufinden hat.
Dieses jüngste Buch von Andreas Pflüger, ist der zweite Band einer Trilogie, in der eine blinde Polizistin als Hauptakteurin gegen gefährlichste Verbrecher anzukämpfen hat. „Endgültig“ heißt der erste Band, „Niemals“ der zweite. Jenny Aaron ist Mitglied einer fiktiven deutschen Spezialeinheit, die in besonders heiklen Fällen im In- und Ausland eigesetzt wird, um mit ihrem perfekt geschulten Personal präzise Operationen gegen Verbrecher und deren Organisationen durchzuführen. Und so wirkt es nicht aufgesetzt, sondern folgerichtig, dass Jenny Aaron sich auch auf dem berühmten, ebenso weiten wie bevölkerten Platz Djemaa el Fna in Marrakesch zurechtzufinden hat.
Aaron nutzt den Bordstein der Allee als Leitlinie. Kaleschen dicht an dicht; Geschirre knirschen, sie riecht Pferdeäpfel. Fünf Minuten später erreicht sie den eigentlichen Platz und springt auf das Klangkarussell. Die hellen Glöckchen der Wasserverkäufer mit den lustigen Hüten umschwirren Aaron. Im Gewitter von tausend Trommeln nähert sie sich den Gauklern. Als sie Spiritus riecht, Hitze spürt und jemand sie mit einem Triller arabischer Laute am Schlafittchen packt, um sie in eine andere Richtung zu drängen, weiß Aaron, dass sie einem Feuerschlucker zu nahe gekommen ist.
Die bei einem Einsatz erblindete Jenny Aaron leistet Erstaunliches, hat ihre übrigen Sinne bis ins Extreme trainiert, um in der Welt der Sehenden zu bestehen. Speziell in ihrer Abteilung, die bevölkert wird von besonders harten Jungs mit weichem Herzen, Menschen, die meist nur in Halbsätzen miteinander kommunizieren und ebenso blitzschnell kombinieren wie zuschlagen. Es ist das unverkennbare Merkmal von Thrillern: Ihre Helden scheinen mehr Leben zu haben als nur die sieben, die Katzen zugeschrieben werden.
Aarons rechter Arm ist doppelt so schwer wie der andere. Die Walther glitscht fast aus der blutverschmierten Hand. Keyes wirft sich gegen die Tür und taumelt. Aaron sieht das Loch in seinem Hosenbein. Schuss in die Wade. Sie schnellt wie eine Stahlfeder auf ihn zu, reißt ihn ins Treppenhaus, vollführt einen halben Salto mit ihm und dreht ihre Knochen durch die Mangel. Als Keyes noch zu verstehen versucht, was gerade passiert ist, steht sie schon wieder und schleudert ihre High Heels weg.
 Aaron und ihre Kollegen sind dem so genannten Broker hinterher, einem Mann der terroristische Anschläge in aller Welt organisieren lässt, um von den daraufhin erfolgenden Kurssprüngen der Aktien von Waffen- und Sicherheitsfirmen an den Börsen zu profitieren. Die Autoren aktueller Polit-Thriller nehmen sowohl die Realität als auch die technische Entwicklung und drehen beides um ein Rädchen weiter. So wie in Pflügers „Niemals“.
Aaron und ihre Kollegen sind dem so genannten Broker hinterher, einem Mann der terroristische Anschläge in aller Welt organisieren lässt, um von den daraufhin erfolgenden Kurssprüngen der Aktien von Waffen- und Sicherheitsfirmen an den Börsen zu profitieren. Die Autoren aktueller Polit-Thriller nehmen sowohl die Realität als auch die technische Entwicklung und drehen beides um ein Rädchen weiter. So wie in Pflügers „Niemals“.
Die App generiert ein Spiegelbild seiner Stimme. Krampe hat ein Faible für Lyrik und ein Gedicht ausgewählt, das alle nötigen Laute für einen perfekten Klon enthält. Es ist von Robert Gernhardt und heißt: „Der ICE hat eine Bremsstörung hinter Karlsruhe“. Zähneknirschend hebt Nussknacker an: „Lila umflammt der Flieder die Hütte …“ Pavlik schießt ihm das linke Ohrläppchen weg. „Wie ich sagte: Lies es mit deiner normalen Stimme.“
Noch sind solche Apps, mithilfe derer man in der Telefonübermittlung die Stimme eines anderen annehmen kann, nicht auf dem Markt. Es wird aber wohl nicht mehr lange dauern. Autoren von Agenten-Romanen scheinen sich somit auch in dieser veränderten Welt der Spionage zurechtzufinden. Das zeigt ein Blick auf die Neuerscheinungen der letzten Zeit: Veit Etzold hat vor einem Jahr in „Dark Web“ über den Cyber-Kriminalität geschrieben, Christian von Ditfurth wenig später in „Giftflut“ über Anschläge auf die Infrasturktur in Europa. Wieder ist es eine unbekannte Größe, die Krieg führt. Sie ruft Angst hervor und damit Übergriffe auf Minderheiten und Stärkung von Rechtsparteien.
Der Amerikaner Olen Steinhauer schrieb 2016 den Roman „Der Anruf“, in dem es um die CIA und einen Anschlag auf den Flughafen Wien geht. Es handelt sich um einen Autor von Spionage-Thrillern, der sich auch laut Thomas Wörtche mit China und mit dem Nahen Osten als Thema beschäftigt: „Stichwort Arabischer Frühling und der totale Kontrollverlust der USA, und so weiter. Das sind schon Themen, die er sehr gut drauf hat.“
Noch etwas hebt den aktuellen Agenten-Roman von den Vorgängern dieses Genres ab. In den Romanen des „Zeit“-Redakteurs Yassin Musharbash spielen Medien, nicht nur wegen der eigenen beruflichen Identität, eine wichtige Rolle:
„Medien lassen sich davon gar nicht mehr trennen. Wenn ich über Terror schreibe, muss ich über Terrorbekämpfer schreiben, muss ich über Medien schreiben, weil das ein Dreieck ist. Ich kann nicht so tun, als gäbe es nur diese Zweierbeziehung. Im Kalten Krieg waren die Medien nicht der Hauptaustragungsort, aber in dieser aktuellen Auseinandersetzung spielen sie eine große Rolle. Wenn Medien aber eine Rolle spielen, spielt auch Öffentlichkeit eine Rolle, Beeinflussung der Öffentlichkeit, das Echo, die Stimmung in der Gesellschaft. Das heißt, ich muss das mit beschreiben. Das muss irgendwie abgebildet werden.“
Abgebildet wird im modernen Agentenroman eine Momentaufnahme der Gesellschaft: Bedroht aus unterschiedlichen Richtungen, informiert, sehr oft auch falsch informiert, aus ebenso vielen, aus ebenso nicht verifizierbaren Richtungen. Auch der Berliner Buchhändler Christian Koch kennt aktuelle Romane, die solche neue Themen, etwa die Sicherheit im Internet, behandeln:
„Es ist eine große Vielfältigkeit da. Ich glaube, manche Autoren haben Mut zu dem Neuen, andere gehen bewusst auf das Alte zurück, so wie Coelho jetzt mit dem Roman um Mata Hari, aber das gab es schon immer in der Literatur wie in der Krimiliteratur.“
 Vor zwei Jahren ist Paulo Coelhos historischer Agenten-Roman „Die Spionin“ über die legendäre Mata Hari erschienen. Der schmale Band besteht aus einem fiktiven letzten Brief der niederländischen Tänzerin, die 1917 von Frankreich als deutsche Spionin verurteilt und hingerichtet wurde. Es ist ein Brief aus dem Gefängnis an ihren Anwalt. Der antwortet ihr ebenfalls mit einem Brief, wenngleich dieser sie nicht mehr erreicht.
Vor zwei Jahren ist Paulo Coelhos historischer Agenten-Roman „Die Spionin“ über die legendäre Mata Hari erschienen. Der schmale Band besteht aus einem fiktiven letzten Brief der niederländischen Tänzerin, die 1917 von Frankreich als deutsche Spionin verurteilt und hingerichtet wurde. Es ist ein Brief aus dem Gefängnis an ihren Anwalt. Der antwortet ihr ebenfalls mit einem Brief, wenngleich dieser sie nicht mehr erreicht.
Wenn wir uns nicht fürchten, werden wir immer in einem Palast erwachen; fürchten wir die Schritte, die uns die Liebe abverlangt, und wollen wir ihren Zauber ergründen, bleibt uns am Ende gar nichts. Und das, liebe Mata Hari, war vermutlich Ihr Fehler. Nach jahrelangem Aufenthalt auf dem eisigen Berg haben Sie nicht mehr an die Liebe geglaubt und beschlossen, sie, die Liebe, zu Ihrer Dienerin zu machen. Aber die Liebe gehorcht niemandem und verrät jene, die Ihr Geheimnis aufdecken wollen.
Coelho schlägt sich in seinem Roman über die schillernde Figur aus der Zeit des Ersten Weltkriegs auf die Seite jener, die in Mata Hari nicht wie behauptet eine Doppelagentin, sondern das Opfer von Intrigen und einen Sündenbock der Franzosen sehen. Der Grazer Universitätsprofessor Siegfried Beer sieht Mata Hari wohl ähnlich.
„Das ist, glaube ich, wissenschaftlich durchaus entwickelt worden und gesichert, dass das keine großartige Spionin war. Aber sie steht für eine Tätigkeit und auch für eine Konterspionage fast symbolhaft, mythologisch geradezu. Und das ist in dem Geschäft nicht so selten, dass Mythos und Wahrheit sehr leicht kollidieren.“
 Auch der vietnamesische Autor Viet Thanh Nguyen siedelt sein jüngstes Werk in der Vergangenheit an, der 2017 auf Deutsch erschienenen Spionage-Thriller „Der Sympathisant“ spielt während des Vietnamkriegs und danach. Ebenfalls historische Persönlichkeiten bevölkern den dicken Roman „Das kalte Blut“ von Chris Kraus, erschienen im vorigen Jahr. Eine dieser realen Figuren ist Reinhard Gehlen, der nach dem Krieg den Bundesnachrichtendienst aufbaute.
Auch der vietnamesische Autor Viet Thanh Nguyen siedelt sein jüngstes Werk in der Vergangenheit an, der 2017 auf Deutsch erschienenen Spionage-Thriller „Der Sympathisant“ spielt während des Vietnamkriegs und danach. Ebenfalls historische Persönlichkeiten bevölkern den dicken Roman „Das kalte Blut“ von Chris Kraus, erschienen im vorigen Jahr. Eine dieser realen Figuren ist Reinhard Gehlen, der nach dem Krieg den Bundesnachrichtendienst aufbaute.
Die künstlerische Gestaltung dieser Plakette, die im Übrigen bis heute nachgegossen und um verdiente Agenten-, Spionen- und Verräterhälse gehängt wird, hatte ich selbst zu übernehmen. Als Motiv schlug ich die Elend-Alm vor – Gehlen aber wünschte sich den heiligen Georg, seinen Lieblingsdrachentöter. Als Material wählte ich Blech. Er aber bestand darauf, auf solide Bronze zurückzugreifen und für mich persönlich auf Gold.
„Da ich ja über den BND einen Stoff machen wollte, hätte ich nie gedacht, dass das so ausufert“, gesteht der Autor von „Das kalte Blut“. „Ich wollte eigentlich eine sehr kondensierte Geschichte der wirklich irrwitzigen, aberwitzigen und auch perfiden Gründung des Bundesnachrichtendienstes schreiben. Denn der Bundesnachrichtendienst wurde nahezu ausschließlich von bekennenden Nationalsozialisten oder ehemaligen Nationalsozialisten gegründet. Und dass trotzdem der Bundesnachrichtendienst und viele andere Institutionen, die von Nationalsozialisten durchsetzt waren, letztlich dazu geführt hat, dass wir eine freiheitliche Wertordnung haben, eine Republik, eine Demokratie, das ist das Erstaunliche an der Geschichte unseres Landes.“
Geworden ist aus der Geschichte über den BND ein 1200 Seiten starker Roman, der die Zeit der alten Bundesrepublik anhand der Verstrickung eines Brüderpaares in Geheimdiensttätigkeiten erzählt. Dabei kommt der BND nicht gut weg, er erscheint über weite Strecken amateurhaft. Für den Thriller-Experten Wörtche liegt darin ein Grund, warum früher die Agentenliteratur nicht von deutschen Werken, sondern von Romanen aus dem angloamerikanischen Raum beherrscht wurde:
„Das gab es in Deutschland auch, aber nicht so stark, denn der BND war auch nicht so eine große Nummer. Der BND war ja eher erst mal eine Lachnummer. Ob er das nur geschickterweise war oder vielleicht nicht, das möchte ich nicht beurteilen. Aber es ist natürlich die perfekte Camouflage eines guten Geheimdienstes, sich als völlig blödsinnig darzustellen.“
Der Ich-Erzähler in „Das kalte Blut“ arbeitete nicht nur für den BND und vorher für den SD der Nazis, sondern auch für den israelischen und den sowjetischen Geheimdienst. Dadurch gerät er unbeabsichtigt immer weiter in ein Gestrüpp aus Lügen, Schuld und Verstellung.
Ich war ein wichtiger Kundschafter des KGB geworden, und um mich in unendlicher Abhängigkeit zu halten, um mich in Wachs, in Sand, in Schaum, ja in schwarze Schuhwichse zu verwandeln, mit denen sie ihr System fetten und zum Glänzen bringen konnten, gaben sie mir diese Aussicht. Die nämlich hatte ich verlangt. Eine Aussicht. Einen höher gelegenen Punkt, von dem aus man eine Insel entdecken könnte, wenn sie denn am Horizont auftaucht.
Solche Doppel-, Tripel- und Quadrupelspionage erinnert an den Klassiker „Es muss nicht immer Kaviar sein“ des Österreichers Johannes Mario Simmel. Eine deutschsprachige Ausnahme in der Ahnengalerie internationaler Agentenklassiker. Erschienen ist der Roman, der auch verfilmt wurde, im Jahr 1960. Für Thomas Wörtche ist er aus diesem Grund, abseits von Qualitätsbewertungen, bemerkenswert:
„Man muss auch überlegen, was man damals an deutscher Literatur, an schwerer deutscher Bewältigungsliteratur am Wickel hatte. Jetzt kann man natürlich einwenden, mit welcher Seriosität und intellektuellem Aufwand, von Siegfried Lenz über Böll, Grass – und dann kommt dieser freche Simmel und guckt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Man kann sich die Empörung vorstellen damals, gerade unter der seriösen Literaturkritik, wie furchtbar das war. Und dann wurde es auch erfolgreich, also insofern das Schlimmste, was man überhaupt machen kann im Literaturbetrieb. Trotzdem, ich verteidige das immer noch, das ist ein intelligent gemachtes Ding.“
Der Ordonnanz folgend, dachte Thomas: Gestern war ich noch in Paris. Jetzt bin ich hier im Reichssicherheitshauptamt. Ich, ein friedlicher Bürger, ein Mann, der die Geheimdienste, die Nazis, Gewalt und Lüge haßt. Ich, Thomas Lieven, den man seit Jahren nicht mehr in Frieden leben lässt.
Dieser Thomas Lieven wird im Zweiten Weltkrieg wider Willen zur Mitarbeit in einem Geheimdienst nach dem anderen gezwungen, führt sie aber alle an der Nase herum. Nicht zuletzt mit seinen ausgewählten Kochkünsten. Eine Novität bringt da Simmel in die Belletristik ein, denn er streut die Rezepte jener Speisen in den Text, die Lieven zubereitet. Etwa Parmesanpudding, Rehrücken Baden-Baden und russische Creme. Thomas Wörtche bezeichnet es als sensationell, dass ein Mehrfachagent, eine moralisch graue Figur, zum Romanhelden gemacht werden kann. Und auch noch ausgestattet mit einem vernünftigen politischen Kern.
„Nämlich: Wie bleibt man anständig in schwierigen Zeiten, was ja viel ausmachte. Und er spielt sie alle aus gegeneinander. Das ist natürlich ein Picaro-Roman, das ist ein Schelmenroman. Aber insofern ist das schon auch ein wichtiges Buch, weil das ein bisschen die deutschen Zimmer gelüftet hat, viel mehr als die literarische Avantgarde übrigens.“
Hier saßen sie zu Haufen, Agenten und Agentinnen, die in Luxus und Wohlstand ihr ebenso gemeines wie idiotisches Handwerk betrieben – im Namen der jeweiligen Vaterländer. Im Grunde waren sich alle diese Leute unendlich ähnlich. Sie waren alle eher schüchtern und umgaben sich deshalb unablässig mit den lächerlichen Attributen ihrer Macht, ihres Geheimnisses, ihres Schreckens.
Johannes Mario Simmel gießt über hunderte Seiten seinen Spott über der Geheimdienstbranche aus. Und er verwendet Ingredienzien für seinen Roman, die dem damaligen Publikum wichtig waren, wonach ihm zwischen Nachkriegsjahren und Wirtschaftswunder als Beigabe zum Lesestoff verlangte: Glamour, schöne Frauen, schicke Autos. Ingredienzien, die auch eine andere Romanfigur jener Zeit ausmachten – und sie bis heute definieren: James Bond.
Bond sprang in seinen Bentley und dankte der Eingebung, die ihn dazu gebracht hatte, den Wagen nach dem Essen herzufahren. Mit voll gezogenem Choke reagierte der Motor sofort auf den Anlasser, und das Dröhnen übertönte die zögernden Worte des Hotelportiers, der zur Seite Sprang, als die Hinterräder Kies gegen seine Hosenbeine schleuderten.
 „Casino Royale“ aus dem Jahr 1953, der erste James Bond-Roman des britischen Autors Ian Fleming, liest sich heute etwas bieder und antiquiert, die Verfolgungsszenen holpern. Schon bald wurde aus dem Roman- ein Leinwandheld. Heute hat der Supermann Agent 007 im Geheimdienst ihrer Majestät aber wohl nur mehr den Namen mit der Schöpfung von Ian Fleming gemein. Thomas Wörtche:
„Casino Royale“ aus dem Jahr 1953, der erste James Bond-Roman des britischen Autors Ian Fleming, liest sich heute etwas bieder und antiquiert, die Verfolgungsszenen holpern. Schon bald wurde aus dem Roman- ein Leinwandheld. Heute hat der Supermann Agent 007 im Geheimdienst ihrer Majestät aber wohl nur mehr den Namen mit der Schöpfung von Ian Fleming gemein. Thomas Wörtche:
„Wenn man Freude an James Bond haben möchte, muss man sich wirklich, glaube ich, auf die Filme kaprizieren. Ian Fleming war ein grottiger Schriftsteller, ungeschlacht, hölzern, furchtbar. Das ist museal geworden. Die Filme haben es einfach geschafft, weil sie eben immer Pop-Produkte waren und auf die jeweiligen Pop-Signale reagiert haben. Das sieht man an den Outfits, an den schicken Autos.“
Laut dem Historiker Siegfried Beer kam Ian Fleming schon früh mit Spionage als auch Literatur in Kontakt, lange bevor er beides zum Beruf machte.
„Ian Fleming ist in den späten 20er Jahren von seiner Mutter, da er überall rausgeflogen ist, in Eaton und in Sandhurst und wie diese Zentren alle heißen, nach Österreich geschickt worden, nach Tirol und hat in der Nähe von Kufstein Deutsch gelernt. Bei einem britischen Ehepaar, wo er Geheimdienstmann in Pension war und sie Schriftstellerin.“
Ein anderer Landsmann von Ian Fleming hatte ebenfalls seine ersten geheimdienstlichen Erfahrungen in Österreich gemacht:
„John le Carré, also David Cornwell, war gerade in einem Alter, in dem er britischen Militärdienst machen musste. Und weil er so gut deutsch konnte, durch seine Schulbesuche in der Schweiz und auch die ersten Jahre auf der Uni in Genf oder in Bern, wurde er in die Steiermark geschickt, um für den militärischen Nachrichtendienst FSS zu arbeiten. Das waren Leute, die vor allem im Grenzbereich zum Ostblock, also im Süden Österreichs, in Jugoslawien, Ungarn und natürlich auch der CSSR eingesetzt wurden. Er aber war in der Steiermark stationiert, in Graz und Fürstenfeld, und hat hier Interviews gemacht. Ich wollte ihn zu einer Konferenz einladen. Er hat mir einen handgeschriebenen Brief geschrieben, ich möge verstehen, er will jedes Jahr einen Roman schreiben, und er muss alle seine Kraft da hineinlegen, und er macht keine Reisen mehr.“
Dieses Bemühen nahezu jährlich einen neuen Roman auf den Markt zu bringen, zeigt deutlich die Entwicklung, die John le Carré parallel zur Entwicklung des Geheimdienstwesens genommen hat. Ein Buchhändler nennt ihn den Inbegriff eines sich wandelnden Autors. Für den Historiker Beer ist le Carré wörtlich ein kalter Krieger durch und durch, aber:
„Die letzten Romane sind nicht mehr abgeleitet aus der Kalten Kriegserfahrung, sondern er hat sich wirklich umgestellt auf die neuen Probleme. Daher sind die Schauplätze auch nicht mehr in erster Linie europäisch, sondern durchaus global. Man könnte fast sagen, bei Ian Fleming zeigen auch die Filme diese Veränderung. Das ist logischer weise nicht mehr das Drehbuch des Ian Fleming, aber James Bond muss auch angepasst werden. Und es gibt so etwas wie die Demokratisierung der Spionage.“
 Le Carée taucht in jedem Gespräch über Spionage-Romane auf. Der Brite mit dem französischen Künstlernamen ist die zentrale Figur der Spionageliteratur, vielleicht deren bedeutendster Vertreter über die Zeit hinweg. Jenen Roman, mit dem er berühmt wurde, „Der Spion, der aus der Kälte kam“, brachte er 1963 heraus.
Le Carée taucht in jedem Gespräch über Spionage-Romane auf. Der Brite mit dem französischen Künstlernamen ist die zentrale Figur der Spionageliteratur, vielleicht deren bedeutendster Vertreter über die Zeit hinweg. Jenen Roman, mit dem er berühmt wurde, „Der Spion, der aus der Kälte kam“, brachte er 1963 heraus.
Er nahm an, dass er nach wie vor beschattet wurde, also ging er zur Fleet Street und trank im Black and White einen Kaffee. Er bummelte von Buchladen zu Buchladen, las die Abendzeitungen, die in den Schaukästen der Pressehäuser aushingen, und dann, als wäre es ihm ganz spontan eingefallen, sprang er in einen eben anfahrenden Bus.
„Dinge, die er schildert, sind mir in meinem Leben schon passiert“, sagt anerkennend der Fachmann aus der Praxis, der Spion Topas, alias Rainer Rupp. „Diese kleinen Andeutungen, die an sich überhaupt nichts sagen, dem ungeübten Auge oder dem Betrachter, der das als ganz natürlich nimmt. In der Kombination mit anderem ergibt sich dann ein Muster, das die Person verdächtig macht. Aber dafür muss man Augen haben, die dieses Muster erkennen, und dafür muss man geschult sein oder es selbst erlebt haben.“ John le Carré ist geschult, hat es erlebt. Auch wenn er sich selbst gegen Klischees zu wehren versucht. Und im Vorwort zur Neuauflage vom „Spion der aus der Kälte kam“, ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen, seinen Zorn artikuliert.
Zorn, weil mir klar wurde, dass ich nun für alle Zeiten der schreibende Spion sein würde statt ein Schriftsteller, der, wie so viele seiner Art, eine Weile beim Geheimdienst gewesen war und darüber geschrieben hat. Die damaligen Journalisten interessierte das alles nicht. Und da ich für ein Publikum schrieb, das süchtig nach Bond war und verzweifelt ein Gegenmittel suchte, hielt der Mythos sich.
Für den Schriftsteller und „Zeit“-Autor Yassin Musharbash ist John le Carré ein Musterbeispiel für die schriftstellerische Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, ein lebender Beweis, dass dieses Genre sehr wohl weiter existieren kann.
„Er hat das ja auch selber erzählt, wie nach dem Fall der Mauer ihm Leute mitleidig auf die Schulter geklopft haben und ihn gefragt haben: was willst du denn jetzt bloß machen? Und er dann aber gar kein Problem hatte, sich andere Sujets zu suchen. Er hat über internationale Konzerne geschrieben und deren Machenschaften, die Pharmaindustrie in Afrika oder über Banken, die russische Mafia. Das heißt, er hat sich quasi nie reduzieren lassen auf nur dieses Ost-West-Ding. Und er wusste auch, dass es irgendwann albern ist, wenn man zehn Jahre nach dem Fall der Mauer so tut, als würde sie noch stehen. Aber dann kam natürlich der 11. September. Und ich glaube schon, dass ich nicht der einzige war, der sich gefragt hat, wie reagiert so jemand wie John le Carré darauf? Er hat dann lange gewartet, und die Antwort war „A Most Wanted Man“. Im Grunde ein Buch über Guamtanamo. Das war sein Kommentar dazu.“
 Hinter Musharbashs Schreibtisch stehen Bücher von und über John le Caré. Nicht zufällig. Er hat zwei Jahre lang als Rechercheur für den Schriftsteller gearbeitet und bezeichnet es als ein Privileg, beim Entstehen eines Buches mittun zu können, Porträts von Figuren zu entwickeln, Fakten zu erheben. Fakten, die sich im Lauf der Jahrzehnte kräftig gewandelt haben. Abzulesen an einem der neueren Romane von John le Carré, „Empfindliche Wahrheit“, wo es um eine militärische Operation gegen den internationalen Terror geht, an der das Außenamt gemeinsam mit privaten Diensten beteiligt ist.
Hinter Musharbashs Schreibtisch stehen Bücher von und über John le Caré. Nicht zufällig. Er hat zwei Jahre lang als Rechercheur für den Schriftsteller gearbeitet und bezeichnet es als ein Privileg, beim Entstehen eines Buches mittun zu können, Porträts von Figuren zu entwickeln, Fakten zu erheben. Fakten, die sich im Lauf der Jahrzehnte kräftig gewandelt haben. Abzulesen an einem der neueren Romane von John le Carré, „Empfindliche Wahrheit“, wo es um eine militärische Operation gegen den internationalen Terror geht, an der das Außenamt gemeinsam mit privaten Diensten beteiligt ist.
Private Militärdienstleister. Wo leben Sie Mann? Privat ist heutzutage die Devise. Der Krieg ist in Unternehmerhand, falls Sie das noch nicht mitgekriegt haben. Berufsarmeen haben ausgedient. Kopflastig, schlecht ausgestattet, ein Brigadegeneral für zehn Hanseln und sündteuer dazu. Setzen Sie sich ein paar Jährchen ins Verteidigungsministerium, wenn Sie mir nicht glauben.
Söldnertum, Outsourcing, Kritik an neoliberalen Auswüchsen: Damit ist le Carré wieder auf der Höhe der Zeit. Letztlich ist auch der Whistleblower Edward Snowdon ein Produkt dieser Entwicklung, sagt der Grazer Geheimdienstexperte Siegfried Beer:
„Snowdon hatte ja keine wirkliche CIA- oder NSA-Anstellung. Er arbeitete für eine Firma, die zugearbeitet hat. Und das zeigt ja schon das Problem. Ich halte ihn deshalb nicht für einen Whistleblower. Whistleblower sind Leute, die im System bleiben, und das hat es in Amerika auch gegeben. Er ist ja zum Feind übergelaufen. Für mich ist der Snowden ein Überläufer im klassischen Sinn.“
Intransparenz
Im Berliner Bezirk Kreuzberg, ein paar Meter neben der Marheineke-Markthalle, befindet sich im Erdgeschoß eines Wohnhauses die Buchhandlung Hammet. Sie ist eine von nicht einmal einem Dutzend Buchhandlungen in Deutschland, die ausschließlich gebrauchte und neue Spannungsliteratur anbietet. Ihren Namen hat sie vom US-amerikanischen Autor Dashiell Hammett, der durch den mehrmals verfilmten Roman „Der Malteser Falke“ bekannt geworden ist.
 Hinter der Kasse steht Inhaber Christian Koch und überlegt, welche aktuellen Spionage-Schriftsteller ihm gerade in den Sinn kommen:
Hinter der Kasse steht Inhaber Christian Koch und überlegt, welche aktuellen Spionage-Schriftsteller ihm gerade in den Sinn kommen:
„Bei den neueren Autoren gibt es durchaus interessante, gar nicht so verbreitete Autoren. Das ist zum Beispiel ein Amerikaner, Olen Steinhauer, eine amerikanische Autorin namens Jenny Siler. Ein britischer Autor fällt mir noch ein, Charles Cumming. Es gibt durchaus neue Stimmen. Und auch wenn er schon zehn, zwölf Jahre alt ist: Der amerikanische Autor Robert Littell mit „Die kalte Legende“. Das ist für mich der Inbegriff von einem guten Agenten-Roman, der auch die Wahnwitzigkeit dieser Parallelwelt aufzeigt.“
Rund 6400 Buchtitel finden sich dicht gedrängt in dem kleinen Laden, zwei Räumen mit Dielenboden, deren schwarze Holzregale mit gruseligem Lesestoff vollgestellt sind, von Agatha Christie bis Patricia Highsmith. Manche Titel sagen schon alles: „Nachts in der Stadt“, „Poesie der Hölle“ oder „Ich bin böse“. Aus dem Antiquariat leuchten gelb-schwarze Krimis des Diogenes-Verlags. Agentenromane lassen sich aber nur wenige finden.
„Ich hätte gerne einen größeren Anteil, was meinen eigenen Lesegeschmack angeht“, sagt Buchhändler Koch. „Aber es hat leider, glaube ich, durch die politischen Gegebenheiten, sprich Ende des Kalten Krieges, ein bisschen den Ruf eines altbackenen Untergenres bekommen, was ich überhaupt nicht finde. Denn ich finde, der Agenten-Thriller oder Agenten-Kriminalroman hat heute noch genauso seine Berechtigung. Es ist aber eher ein Randbereich in diesem Genre.“
Doch was ist es, was den Agentenroman einst wie jetzt dennoch reizvoll für die Leser macht? Für den Autor Andreas Pflüger ist es die Schlüssellochperspektive.
„Die Welt der Geheimdienste und der Polizeibehörden ist ja für die meisten Menschen völlig undurchschaubar. Die Möglichkeit, die Mechanismen zu zeigen, nach denen die Sicherheitsarchitektur funktioniert, aufgebaut ist, diese Bausteine ein bisschen bloß zu legen, den Putz davon abzukratzen, sodass man sieht, woraus das Haus gebaut ist, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe und natürlich auch die Eröffnung einer Welt, die einem fremd ist, aber in der man vielleicht manchmal so nochmal wie ein kleiner Junge gerne leben würde.“
Ein paar Kilometer von der Krimibuchhandlung Hammet entfernt, wo die Gattung zum literarischen Randbereich geworden ist, spielt sie die Hauptrolle. Während an der Tür des Buchladens Hammett „Berlin ist Krimistadt“ steht, ist in einem Fenster des Deutschen Spionagemuseums am Leipziger Platz in großen Lettern zu lesen: „Berlin – Hauptstadt der Spione“. An die 300.000 Besucher kommen in das seit zwei Jahren neu konzipierte Museum am ehemaligen Mauerstreifen und lassen sich von den ausgestellten Schaustücken beeindrucken: Als Zigarettenschachteln getarnte Mikrofone, Regenschirme mit eingebauten Giftspritzen, Miniaturkameras, präparierte Koffer und Schuhabsätze.
Die Objekte wirken ein wenig wie aus der Zeit gefallen, und doch werden einige der Spionagepraktiken auch heute noch angewendet. Etwa schöne Frauen oder attraktive Männer als Köder auf bestimmte Personen anzusetzen. Honigfalle oder Romeo-Trick wird das Ausspionieren mittels eingefädelter Liebschaft im Fachjargon genannt, sagt Museums-Kurator Franz-Michael Günther.
„Man meinte, dass das in die Geschichte des Kalten Krieges gehört. Aber heutzutage hat der militärische Abschirmdienst in Deutschland scharfe Filtersysteme dafür entwickelt und muss die weiterentwickeln, weil die Chinesen über die Romeo-Falle, die Honigfalle, in die Bundeswehr reindrücken, um Informationen rauszukriegen. Also nicht nur die Automobilindustrie ist im Visier, was Industriespionage, Wirtschaftsspionage anbetrifft, sondern es sind auch militärische Bereiche.“
In einer langen Vitrine des Museums stehen Reihen von Sachbüchern zum Thema, die Sammlung eines einstigen Spions des Dritten Reichs, der sie dem Spionagemuseum vermacht hat. Günther spricht von einem Paradigmenwechsel nach dem Kalten Krieg, die Geheimdienste hätten sich neu erfinden müssen und müssten sich neuen Themen stellen.
Auch Yassin Musharbash hat die Veränderungen bei seiner Arbeit mit Geheimdiensten festgestellt.
„Der Verfassungsschutz in Deutschland, das gilt vergleichbar bestimmt auch für den BND, war sehr, sehr lange zutiefst im Kalten Krieg-Denken verhaftet. Dann gab es einen enormen Professionalisierungsschub nach dem 11. September und auch eine Verjüngung. Der klassische Spion, so wie er in den frühen Büchern von John le Carrée zum Beispiel auftaucht, der noch seinen eigenen Mittelwellensender mit über die feindlichen Linien schleppt und irgendwo im Wald vergräbt, damit er ihn drei Monate später irgendwo aktivieren kann, um irgendwas nach Hause zu funken, das ist ja sozusagen Steinzeit, Pleistozän, im Vergleich zu den Möglichkeiten, die jeder heute mit seiner Armbanduhr hat oder seinem Handy.“
Mittlerweile fliegen Drohnen durch die Romane der Spionage-Schriftsteller von heute. Das Kumpelige, Schlapphutartige wie vor 20 Jahren, das niemand ernst genommen hätte, treffe man heute in den Geheimdiensten nicht mehr an, sagt Musharbash. Vielmehr seien diese mit Think-Tank-Personal vergleichbar, weit analytischer als früher. Was der Grazer Geheimdienstexperte Siegfried Beer bestätigt. Als er bei der CIA zu Besuch war, sei er sich wie auf einer Universität vorgekommen, umgeben von Akademikern. Und, was für die Autoren von heute besonders interessant sein dürfte:
„Seit den 80er Jahren gibt es das Phänomen der Öffnung von nachrichtendienstlichen Einrichtungen im Sinne von Zugang in Archiven. Aber das ist natürlich nicht allgemein gültig, sondern betrifft vor allem Amerika, wo der Freedom of Information Act natürlich Druck gemacht hat, wo aber auch die Bereitschaft der CIA viel schneller vorhanden war, über Vorgängerorganisationen Akten freizugeben.“
Bleibt also aufgrund der Technisierung der Spionagebranche den Romanautoren nur mehr der Gang ins Archiv? Laut Museumskurator Franz-Michael Günther ist die Situation keineswegs so hoffnungslos.
„Grundsätzlich hat sich die Welt nach dem analogen Zeitalter des Kalten Krieges bis 91 schon sehr stark verändert. Andere Technologien und Techniken, ganz andere Möglichkeiten der Informationsgewinnung und -ausarbeitung sind entstanden. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Agent als menschliche Ressource und Spion immer noch gefragt und ist nach wie vor wichtig.“
Dem pflichtet der Autor Yassin Musharbash bei:
„Die Bedeutung von Signal Intelligence ist viel größer geworden, über die letzten rund zwei Jahrzehnte hinweg, und trotzdem sagt ein jeder gestandene Geheimdienstler, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland: Ohne Human Intelligence nützt uns das alles nix. Am Ende ist es manchmal immer noch entscheidend, dass einer einem anderen in die Augen guckt und redet, ein vertrauliches Gespräch führt.“
Der Fachmann für Agentenromane, Thomas Wörtche, beobachtet auch in der Literatur eine Verschiebung. Die aktuellen Romane seien nicht mehr reine Spionage-Thriller. Immer stärker verzahne sich darin Kriminalität mit Politik.
„Das ist sozusagen in neue Aufklärungsmethoden elektronischer Art, in neue Gesamtlagen aufgelöst. Wir haben keinen Kalten Krieg mehr, das ist klar. Aber Agenten haben wir natürlich, das heißt also Leute, die im Sinne merkwürdiger Staatsräson und möglicherweise innerhalb eines Staates gegen die Staatsräson agieren. Das heißt, das ist alles da und in diesem politischen Krimi drin.“
Laut dem Autor Andreas Pflüger löst sich der Agentenroman in der allgemeinen Thriller-Literatur auf. Diese aber hat laut Thomas Wörtche einen Prestigeverlust erlitten, was er auf eine vom Marketing getriebene Umwertung des Wortes Thriller zurückführt:
„Thriller war früher eine Edelklasse. Psychothriller, das waren Patricia Highsmith und Margaret Millar. Heute schreibt man auf jeden Zero-Killer-Roman, wo irgendeiner slasht und metzelt, weil er zu früh vom Töpfchen geschubst wurde oder Ähnliches, „Thriller“. Und das verschiebt natürlich die Leseerwartung. Deswegen hieß es: Äh, Polit-Thriller, ich weiß nicht, das ist gar kein Thriller, da gibt es ja gar kein Monster mit dem Hackebeil, so etwas lese ich nicht. Insofern ist das ein bisschen durch diese merkwürdige Umlabelung in Vergessenheit geraten, ein bisschen in den Schatten gerückt, sagen wir so.“
Mag sein, dass etwas, was früher als klassischer Agenten-Roman galt, heute nicht mehr so leicht erkennbar, nicht mehr so leicht einzuordnen ist. Eines aber ist trotz aller technischer Hochrüstung der Branche in den Romanen gleich geblieben: Der Mensch, ein Held als Hauptfigur. Bei dessen Modellierung müsse man als Autor aber heute vorsichtig sein, warnt Yassin Musharbash.
„Es gibt immer noch dieses Superheldentum. Jetzt ist James Bond oftmals Terrorbekämpfer sozusagen. Und da finde ich das fast noch problematischer, als würde man solche Figuren in der Geschichte zurückverlegen. Denn diese Typen gibt es definitiv heute nicht mehr. Es gibt in der Terrorbekämpfung keine James Bond-Figuren. Und wer mit solchen Helden ausgestattete Romane schreibt, der kommentiert nicht die Gegenwart. Auch wenn alles andere drum herum stimmig geschildert sein mag. Ich glaube, dass die Zeit, in der wir leben, dieses Terrorthema, diese Terrorismus-Bedrohung, vor allem dadurch gekennzeichnet ist, wie wenig wir wissen. Und das ist eigentlich auch ein klassisches Spionagedilemma. Das ist etwas, was gute Spione immer gewusst haben.“
Musharbashs Kollege Andreas Pflüger sieht für den Agenten-Roman optimistisch in die Zukunft.
„Der Polit-Thriller wird auch vor allem deshalb aktuell sein, weil es in einem guten Kriminalroman oder guten Thriller immer auch um Gerechtigkeit geht. Das ist etwas, das nach meiner Überzeugung die Faszination des Genres ausmacht. In einem Kriminalroman, in einem Thriller, wird am Ende Gerechtigkeit geübt. Und wenn Sie mir einen Thriller zeigen, bei dem das am Ende nicht der Fall ist, dann will ich mir den unbedingt sofort kaufen, um zu sehen, wie der Kollege gescheitert ist. Das gibt es nicht. Und ein Spionagethriller oder auch ein sonstiger Thriller ist ein Buch, das immer von Gerechtigkeit handelt und am Ende diese Gerechtigkeit in einer Welt herstellt, in der es so etwas eigentlich gar nicht gibt.“
Die Zukunft könnte laut Pflüger ein wenig anders aussehen:
„Ich könnte mir in Bezug auf das Agenten-Thriller-Genre vorstellen, dass vielleicht in den nächsten Jahren eine Erzählung interessant werden könnte, die nicht aus der Perspektive der so genannten Guten passiert, also nicht zeigt, wie diejenigen, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, nun agieren. Ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass man vielleicht stärker eine Faszination entwickelt für die Denkweise und die Mechanismen auf der anderen Seite. So wie auch im Fernsehen, im Kino vor einer Reihe von Jahren begonnen wurde, Geschichten mit negativen Helden zu schreiben, die wahnsinnig erfolgreich wurden. Zum Beispiel „Breaking Bad“ oder „Die Sopranos“ und so weiter. Mich persönlich würde es nicht interessieren. In meinen Geschichten mag ich gerne einen Helden oder eine Heldin, mit der ich mich identifizieren kann und die nicht pejorativ besetzt ist.“
Ungewiss ist vor allem die Entwicklung in der Realität. Der Grazer Wissenschaftler Siegfried Beer weist dabei auf den hohen Einsatz an Ressourcen der Geheimdienste hin:
„Seit 9/11 geben die Amerikaner dreimal so viel aus wie im Kalten Krieg. Und das wird sich nicht ändern. Erst recht nicht unter Trump. Die Grunddisposition, was Spionage erreichen soll und erreichen kann, ist nicht so stark verändert. Und daher brauchen die potenten Geheimdienste natürlich jetzt andere Leute, Leute, die Sprachen können, die sich aber auch wie früher in einer Bevölkerung einnisten können. Das können dann keine Amerikaner sein, sondern das müssen Leute sein, die von außen kommen, und da haben die Amerikaner ja genug. Dass Trump die Muslime fernhält, macht jetzt die Geheimdienste total nervös, denn das sind Leute, die sie brauchen, die sie schon angeheuert haben im Irak, im Nahen Osten. Das sind die Leute, die herankommen an Informationen.“
Als zumindest zweitältestes Gewerbe hat der Historiker Beer die Spionage bezeichnet. Sie hat sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten dramatisch verändert, nicht aber in ihrem Kern. Mit ihr hat sich auch die Agentenliteratur verändert: Ihre Handlungsorte sind internationaler geworden, die Themenfelder andere als früher: Terrorismus, Unsicherheit, jeder gegen jeden.
Bestehen wird diese Literaturgattung wohl solange es die Vorbilder im realen Leben gibt. Eine Literaturgattung, die vielleicht mehr leisten muss als manche andere. Das meint jedenfalls Andreas Pflüger.
„Ich erwarte mehr als in der klassischen Romanerzählung von einem Thriller, der immer auch auf eine starke Pointe aufgebaut sein muss, ein Finale, einen Showdown, die Auflösung aller Stränge. Dass der Autor das, was er mir das ganze Buch über permanent verspricht, denn darin besteht ein Thriller, aus dem permanenten Versprechen an den Leser, dass er das am Ende hält. Wenn der Autor dieses Versprechen nicht hält, dann bin ich vergrätzt. Und dann lege ich dieses Buch am Ende wütend zur Seite.“
Für Pflügers Kollegen Yassin Musharbash ist für einen guten Spionage-Roman etwas anderes wesentlich. Deshalb lehnt er auch Bücher mit Superhelden als Protagonisten ab.
„Ich finde nichts öder, nichts langweiliger als Thriller, in denen irgendwelche Superspione eigenhändig den Präsidenten der Vereinigten Staaten in den Keller zerren und ihn gegen 700 angreifende Terroristen verteidigen – mit einem Zahnstocher oder ähnlichem. Das ist alles Quatsch, das ist Eskapismus, das kann vielleicht lustig sein, amüsant. Das ist mir aber zu unernst, weil ich glaube, dass der politische Thriller eigentlich eine ernste Aufgabe hat, eine gesellschaftliche Aufgabe. Es geht darum, das ist zumindest meine Erwartung an ihn, quasi ein kleines Stück in die Zukunft zu gucken, also angelehnt an die Realität aufzuspüren, welche die Unterströmungen sind. Wo treibt und spült uns das hin? Ein guter Polit-Thriller nimmt, glaube ich, etwas vorweg.“
Agentenliteratur als Seismograph. Nicht nur Unterhaltung, sondern Spiegel einer Gesellschaft und Ausblick in die Zukunft. Eine literarische Gattung mit vielen Gesichtern. Einst, heute und künftig.
Stefan May
Stefan May ist Journalist, lebt und arbeitet in Wien und Berlin.