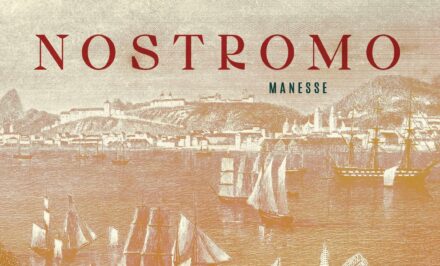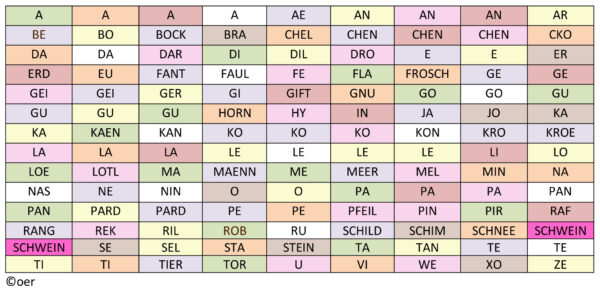Textauszug mit freundlicher Erlaubnis des Autors aus:
Jochen Vogt: Das muss der Reimreinbringer sein – und weitere Rückblenden. Wehrhahn Verlag, Hannover 2024. 160 Seiten, Hardcover, 16 Euro.
Eine Ferienerinnerung
Unter Literaturhistorikern gilt Jörg Fauser neben Rolf-Dieter Brinkmann seit längerem und unbestritten als Wegbereiter der deutschsprachigen Popliteratur: Das Arsenal ihrer »ästhetisch-poetologischen Gemeinsamkeiten«, schreibt der Essener Literaturwissenschaftler Werner Jung, umfasse den »Bezug auf die Alltäglichkeit, die Oberflächen im Hier und Jetzt, den radikalen Bezug auf die Subjektivität des Schreibenden« und »am Ende den Bezug auf US-amerikanische Beat- und Undergroundpoeten mit ihrem crossover der Genres und Stillagen«.
Für seine Freunde aus früherer Zeit und für viele Leser, wohl auch einige Leserinnen, bleibt Jörg Fauser der Mann, der spät in der Nacht nach seinem 43. Geburtstag am 16. Juli 1987, nach einer Feier in Schumann’s Bar, einem Treffpunkt der Münchner Literatenszene, die Autobahn 94 betrat und von einem LKW tödlich erfasst wurde. Charles Schumann, der legendäre ›Barkeeper‹ erinnert sich: Fauser war »auf jeden Fall ein Gast der ersten Stunde.
Und natürlich ein Oberkumpel vom Wondratschek, der hat den Fauser immer mitgenommen. Die haben alle zu viel getrunken, und der Jörg Fauser hat absolut zu viel getrunken. Heute würde ich ihn stoppen und sagen: ›Jetzt ist Schluss, sonst kriegst du eine!‹ Und das war auf jeden Fall einer dieser Abende, an dem er volltrunken war. Aber man hat nie festgestellt wie er dann ungekommen ist als Fußgänger auf der Autobahn nach Riem.‹«
In meiner Erinnerung dagegen lebt Jörg immer noch als Freund des Sommers von 1960, als wir gemeinsam Leichen, oder genauer: Leichenreste ausgebuddelt haben. Das klingt heute wie ein Omen, hatte aber mit Krimis, wie er sie später schrieb und ich sie gerne las, nichts zu tun. Vielmehr waren wir, er 16, ich gerade 17 Jahre alt, mit einer Busladung voller Frankfurter Schüler (natürlich keine -innen!) von der Obrigkeit ins Land des ehemaligen Erbfeinds gesandt worden, um Friedensdienst zu leisten und deutsche Schuld zu sühnen.
Also rackerten wir in unseren Sommerferien drei Wochen lang von früh bis ziemlich spät mit Hacke, Spaten und Schubkarren in einemjener Wäldchen, die heute so idyllisch wirken, weil die gütige Natur das sprichwörtliche Gras und anderes Grünzeug über Knochen und soldatisches Gerät hat wachsen lassen. Eine verwahrloste, fast unkenntliche Grabstätte aus dem Jahr 1916, in einem Buchenwäldchen beim Dorf Lissey im Arrondissement Verdun gelegen, war herzurichten. Lissey hatte damals 150 Einwohner, heute noch knapp über 100; über 800 deutsche Soldaten liegen inzwischen auf dem einigermaßen gepflegten deutschen Soldatenfriedhof, dem »Cimetière militaire allemand«.
Jörg, der aus einem kulturell und politisch engagierten Elternhaus kam und den auch schon der literarische Ehrgeiz gepackt hatte, berichtete darüber bald nach unserer Rückkehr, am 20. August 1960 – auf Anregung des sehr prominenten und politisch engagierten Redakteurs Richard Kirn – im Lokalteil der »Frankfurter Neuen Presse« (20. August 1960) und im typischen Wiedergutmachungston der frühen 1950er-Jahre: »›Reconciliation par-dessus les tombes‹ – Versöhnung über den Gräbern, so heißt es auf dem Transparent über dem Eingang, zwei Hände begegnen sich über einem Kreuz. Vor 44 Jahren mit »Gott für Kaiser und Vaterland«, heute für die Versöhnung; gebüßt haben die Toten, uns bleibt die Versöhnung übrig. Sich versöhnen wollen – Da muß die Schuld eingestanden werden, da muß die Reue, die Einsicht vorher gewesen sein. Die, die Schuld daran getragen, sie sind tot, haben nicht die Friedhöfe 44 Jahre danach gesehen so wie wir den unseren: verwittert die Grabinschriften, 19, 20, 21 Jahre die meisten, zwei, drei Jahre älter als wir heute, ein Leben vor sich, das bald vorbei war.
Wir dürfen dann hier stehen unter den Bäumen, an deren Wurzeln wir uns Schwielen erarbeiten werden, und dürfen nur hoffen, daß das nicht mehr vorkommen wird, nicht in zehn, nicht in hundert Jahren; daß nicht unsere Enkel sich wieder versöhnen müssen über neuen Gräbern, neuen Toten (…), nicht soll es heißen ›Mit Gott für Kaiser und Vaterland‹, heißen vielmehr soll es: ›Für den Frieden!‹. So und ähnlich dachten wir, sprachen es auch aus, und dann den Spaten ergriffen und wir arbeiteten – für die Toten, die Versöhnung, den Frieden.«
Natürlich fühlten wir uns nicht immer so pathetisch. Wir kampierten in 12-Mann-Zelten auf einem schrägen und schlammigen Feld, hatten abends keinen Ausgang (wohin denn auch?) und wurden von einer Küchenbrigade aus Frankfurter Muttis preiswert bekocht. Nein, das war definitiv kein Gulag, aber la douce France war es auch nicht. Immerhin waren dies für die meisten von uns, allesamt aus bescheidenen Verhältnissen, preiswerte Sommerferien und die erste Auslandsreise überhaupt.
Und eine interkulturelle Lernsituation besonderer Art – gerade weil es trotz aller Versöhnungsrhetorik lebenspraktisch kaum zu französisch-deutschen Begegnungen, gar Gesprächen oder Unternehmungen kam, schon gar nicht mit Gleichaltrigen. Am Sonntag wurden wir, streng mononational und ohne jede Gendermischung, im Reisebus zur Besichtigung der historischen Monumente gekarrt – das berüchtigte »Beinhaus« von Douaumont, das die Überreste von mehreren Tausend Gefallenen umschloss, ist mir noch gut in Erinnerung.
Warum war das so? räsonierten Jörg und ich, wenn wir den (einzig freien) Samstagnachmittag bei einem diabolo menthe oder fraise im ziemlich öden Dorfcafé totschlugen; Alkoholisches kam damals noch nicht auf den Tisch. Und weshalb, um die Frage zuzuspitzen, sahen wir nie ein einziges Mädchen auf der Straße? Gab es da etwa eine Absprache zwischen M. le Maire und der Mutti-Brigade? Oder war es sogar möglich, dass ganz Frankreich ein Land ohne junge Frauen war? Diese sehr weitreichende Vermutung hat sich späterhin empirisch auf die eine oder andere Weise selbst widerlegt. Länger hat es gedauert, bis uns die Schiefheit, wenn nicht gar Verlogenheit der ganzen Unternehmung deutlich wurde: Dass wir spätpubertierenden Knaben hier nicht so sehr das Elend unserer Großväter (und deren damaliger Feinde) betrauern als vielmehr die Schuld unserer Väter im Osten und anderswo abarbeiten sollten. Aus deren Generation aber saßen noch einige Herren in den Gremien des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der uns losgeschickt hatte. Vermutlich hätte der eine oder andere von ihnen auch selbst noch einen Spaten halten können.

Jörg und ich haben damals, wenn wir das Geheimnis der Mädchenlosigkeit im gallischen Dorf wieder mal nicht ergründen konnten, auch über unsere Lektüren und Vorlieben gesprochen. Den Lektürekanon der gymnasialen Mittelstufe dominierten bei ihm, im traditionsbewussten humanistischen Lessing-Gymnasium in Frankfurt, die Weimarer Klassiker, bei uns in der eher liberalen Sachsenhäuser Carl-Schurz-Schule die Autoren der Inneren Emigration, in der Oberstufe dann aber, in Anlehnung an die Privatlektüre unseres unkonventionellen Deutschlehrers, Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Jörg und ich schwärmten daneben – ebenfalls sehr zeittypisch – für Gottfried Benn, der bei mir bald von Bertolt Brecht abgelöst wurde (Abituraufsatz über sein Gedicht »Der Radwechsel«!) oder sich vielmehr neben diesem behauptete (auch dies nicht ganz untypisch: man schlage bei Robert Gernhardt nach).
Jörg war mit seiner frühen und überdauernden Vorliebe für die Gegenklassiker Kleist und Grabbe, aber auch für die französischen Surrealisten und die ersten widerborstigen ›Amerikaner‹, von Anfang an schon sehr viel individualistischer.
Nach der Rückkehr aus Frankreich haben wir uns dann leider recht schnell aus den Augen verloren, was wohl tatsächlich daran lag, dass wir in verschiedene Schulen gingen, in verschiedenen Stadtteilen – »hibb un dribb de’ Bach« – und in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus lebten. Jörgs späteres, abenteuerliches und in vieler Hinsicht riskantes Leben in den späten 1960er- und 1970er-Jahren hat er dann in seinem nur leicht getarnten Autobiografieroman Rohstoff (1984) bewegend, aber auch amüsant beschrieben.
Inzwischen hatte er ja ein beträchtliches aber auch heterogenes Œuvre zusammengeschrieben: Gedichte, Reportagen, literarische Sachbücher, etwa eines über Elvis Presley, Songtexte für Achim Reichel und anderes mehr. Vor allem aber zwei oder drei Kriminalromane, von denen Der Schneemann (1981) ein respektabler finanzieller Erfolg war und bald darauf, mit Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle, ebenso erfolgreich verfilmt wurde. Es war nicht zu übersehen, dass Fauser hier Muster der angloamerikanischen Spannungsliteratur auf bundesdeutsche Verhältnisse und in unsere Umgangssprache übertragen hatte. Genau besehen handelt es sich um eine Mischung von Kriminal- und Agentenroman, die an Raymond Chandler und Ross Thomas einerseits, Graham Greene und Erich Ambler anderseits erinnerte. Über sie alle hat Fauser kluge und bis heute nachlesenswerte Essays geschrieben.
Sein eigener jämmerlicher Romanheld, eben der »Schneemann«, ist Blum, ein dubioser Geschäftemacher und Kleinkrimineller, der als uns als Perspektivfigur, wenn nicht gar als Sympathieträger zugemutet wird. Beim Versuch, in Malta seinen Restbestand an alten dänischen Pornoheften zu verscherbeln, fällt ihm auf höchst dubiose Weise ein Gepäckschein und am Münchner Hauptbahnhof schließlich ein Paket mit fünf Kilogramm allerfeinstem peruanischen Kokain in die Hände. Die Handlung folgt nun seiner quasi homerischen Irrfahrt durch schäbige Hotelzimmer, Bahnhöfe, Bierkneipen und Bars, und protokolliert seine ebenso verzweifelten wie glücklosen Versuche, jenen Schatz von kostbarem »Schnee« gewinnbringend zu veräußern, sich dadurch aus seiner lebenslangen Misere zu befreien und vielleicht doch noch den Lebenstraum von einer kleinen Kneipe auf den Bahamas zu verwirklichen. Doch natürlich ist Blum in Frankfurt, in Amsterdam und zuletzt in Ostende längst von einer Horde dubioser Figuren umgeben, die ihm seinen Schatz auf die eine oder andere Art abluchsen wollen (und werden); auch der ursprüngliche, aber keineswegs rechtmäßige Besitzer meldet sich gewaltsam zu Wort, bevor er ebenso endet. Insgesamt spielen Gewalt und Sucht aber eine untergeordnete Rolle. Am Ende kommt Blum, wie zu erwarten, gerade so eben davon: pleite aber lebendig. Dies ist die Geschichte eines losers (wie heute schon die Kinder sagen). Wir dürfen uns an das Märchen vom Hans in Glück erinnern, aber auch an Dashiell Hammetts Krimiparabel vom Malteser Falken (so wie er verflüchtigt sich auch Blums vermeintlicher Schatz, während sich die attraktive Gefährtin als Feindin erweist).
Auch der Romantitel Kleiner Mann – was nun? von Fausers verehrtem Hans Fallada könnte ein treffendes Motto abgeben. Fausers Stärken sind, in der amerikanischen hard boiled-Tradition wie auch des dortigen New Journalism, hierzulande in bemerkenswerter Nähe zu Joseph Roth und Egon Erwin Kisch, knappe aber treffende, oft satirisch zugespitzte Milieubeschreibungen und Dialoge. Szenische Glanzstücke wie eine Party der Münchner Kulturschickeria haben auch nach 40 Jahren ihren Biss nicht verloren.
Fauser ist vor allem ein blendender Stilist – das wurde lange nicht gewürdigt, weil er seine Brillanz in einem zumal in Deutschland noch gering geschätzten Genre demonstrierte.
Als stilistisches Merkmal seiner journalistischen wie auch im engeren Sinne literarischen Arbeiten hat Thomas Wegman, um einen zweiten Essener Literaturwissenschaftler zu zitieren, »die Überlagerung von Sub- und Hochkultur« benannt, den »Antagonismus von originärer Erfahrung und sekundärem Zitat«, der ja »auch die um 1970 sich konstituierenden Jugendkulturen« prägte.
Ich denke, dass man dieses Phänomen der Überlagerung oder der Spannung zwischen zwei Polen nicht nur an Fausers Texturen ablesen kann, sondern dass es eine Autorschaft grundsätzlich charakterisiert und seine trotz des wachsenden Erfolgs prekäre Position im literarischen Feld bestimmt.
Da ist einerseits das Selbstgefühl oder die Haltung, um nicht zu sagen der Gestus des Rebellen, der sich aber – anders als bei manchen schreibenden Generationsgenossen – nicht primär gegen Eltern, Familie und Schule richtet, sondern gegen das politisch-kulturelle Klima der bundesdeutschen 1950er Jahre im Allgemeinen und gegen den etablierten und wie er es empfand, verspießerten Literaturbetrieb im Besonderen. Und andererseits, eine Textproduktion, die sich in ihrer formalen und thematischen Vielseitigkeit und Flexibilität dem expandieren und zunehmen multimedial organisierten Literaturbetrieb geradezu anbietet, dem sich der Autor aus den genannten, eher privat-moralischen Gründen aber vorerst verweigert.
Er steht sich gewissermaßen selbst im Wege, bleibt in einer Art von double-bind gefangen, das ihn immer wieder in paradox anmutende, peinliche oder bedauerliche Situationen führt.

Jörg Fauser sperrt sich offensichtlich lange gegen und beliefert nur widerwillig den Rundfunk, der ihm doch in seiner sachlichen, thematischen und formalen Ausdifferenzierung – und auch in persönlicher Hinsicht alle Chancen bot. Seine Mutter Maria Fauser, vorher Schauspielerin, war ja seit 1955 die Stimme des sogenannten »Frauenfunks« im Frankfurter Funkhaus: wegen ihres Sendetermins früh um Acht hausintern auch »Schreck der Morgenstunde« genannt. Und der kleine Jörg war schon früh als beliebter »Purzel« in den Kindersendungen des Hessischen Rundfunks und bald auch im Fernsehen aufgetreten.
Als er in der 1970er-Jahren dann doch lebhaft und vielseitig produziert, beliefert er ausgerechnet Lifestylemagazine wie »Twen«, oder die sogenannten Herrenmagazine wie »Playboy« und »lui«, oder die neuen Stadtmagazine wie »tip« und »Marabo«, – also Publikationsorgane, die dem Primat des Ökonomischen ja ganz direkt unterworfen und von der Idee einer alternativen Kultur am weitesten entfernt waren.
Zu erinnern wäre wohl auch an Fausers Desaster beim Klagenfurter Dichtertreffen, wo es um den Ingeborg-Bachmann-Preis geht: Da tritt er, der sonst gern Dreiteiler aus edlem Zwirn trägt, ausgerechnet im Hawaiihemd auf und wird nach dem Vortrag seiner Kurzgeschichte »Geh nicht allein durch die Kasbah« von der Kritikergarde unter Vorsitz von Marcel Reich-Ranicki gerade zu vernichtet. Liest man diesen Text heute, so wirkt er handwerklich gelungen, aber keineswegs innovativ, eher ein wenig aus der Zeit gefallen. Das ist, im Setting einer Feriensituation, eine mit Andeutungen und Leerstellen operierende Variation aufs ewige Thema, dass der Mann und die Frau sich nicht verstehen können: Da ist ein wenig Hemingway drin und eine Prise Highsmith, aber ganz viel Gabriele Wohmann. Damit ist 1984, ein Jahr nach dem hemmungslos vor sich hinblutenden Rainald Goetz, sicher kein Preis mehr zu gewinnen.
Für mich – als Freund, nicht als Literaturwissenschaftler – bleibt nur die Frage: Warum hat der gute Jörg sich das nur angetan?
Er konnte auch anders, gewissermaßen selbst in die Reich-Ranicki-Rolle schlüpfen. Das lässt sich zumindest ansatzweise sogar nachlesen, in einem seiner späten Texte – »Leichenschmaus in Loccum« – publiziert in Enzensbergers kurzlebigem Edelmagazin »Transatlantik« (1983). Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum im Jahr zuvor hatte sich Jörg einen spöttisch-aggressiven Rundumschlag nicht nur gegen den Akademiebetrieb als solchen, sondern vor allem gegen die teils anwesenden Autoren des sogenannten Neuen deutschen Kriminalromans geleistet, wobei er doch erheblich unter sein Niveau ging.
Zu jener Zeit waren ja nun, angeregt von der verspäteten Publikation neu übersetzter amerikanischer oder britischer Krimi-Klassiker, von den Schwarzen Serien französischer oder wiederum amerikanischer Herkunft in den Programmkinos und Dritten Fernsehprogrammen auch bundesdeutsche Eigenprodukte im Taschenbuch und auf dem Bildschirm erschienen. Gemeinsam war den meisten dieser Krimiautorinnen und -autoren nicht nur der ›soziologische‹ Ansatz und die Nähe zum sozialliberalen Zeitgeist, sondern auch eine gewisse Sprachnot, die einen Stilisten wie Fauser provozieren musste, besonders wenn sie mit ökonomischem Erfolg gepaart war. Natürlich konnte er sich darüber ärgern, dass durchschnittliche Schreiber für jedes »Tatort«-Drehbuch 35 000 DM bekamen; aber gleichzeitig wollte er eben auch um keinen Preis Drehbuchlieferant und Serienautor werden.
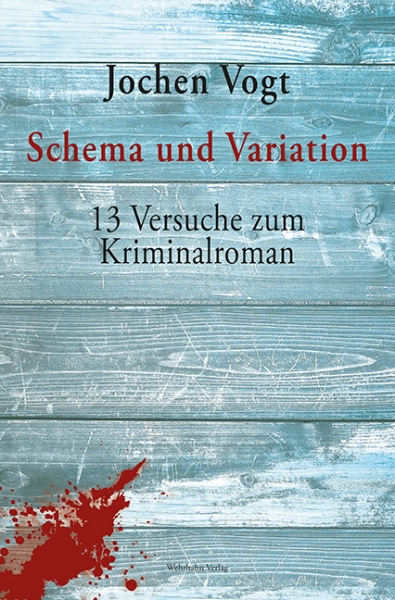
Mein Freund Jörg – wir hatten uns in Loccum ein letztes Mal gesehen – sah sich natürlich und nicht ganz zu Unrecht eher in der Nachfolge von Dashiell Hammetts Roter Ernte und dem Malteser Falken, von Chandlers Tiefem Schlaf und Langem Abschied – das waren ja Bücher, die wir beide, jeder für sich, seit den späteren 1960er Jahren entdeckt und die uns nie mehr losgelassen haben. Inzwischen sind sie alle im deutschsprachigen Olymp der klassischen Kriminalliteratur, also im Diogenes Verlag zu Zürich versammelt. Und wie das Alphabet es will, zwischen Ambler und Chandler einerseits, Hammett und Highsmith andererseits, stehen jetzt dort auch – gleich in zwei verschiedenen Ausgaben – die Bücher von Jörg Fauser mit seinen schönen Essays über all diese Großen und mit seinen eigenen, gar nicht so kleinen Romanen.
** **
Jochen Vogt ist auch bekannt wegen seiner in literaturwissenschaftlichen Kreisen eher ungewöhnlichen wissenschaftlichen Arbeiten zum Kriminalroman als Literaturgattung, heißt es bei Wikipedia. Zum 80. widmete ihm der Redaktionsleiter seiner Zeitung – die WAZ – ein Porträt. Jochen Vogt ist auch Jurymitglied der Krimibestenliste. Ebenfalls im Wehrhahn Verlag von ihm erschienen: „Schema und Variation. 13 Versuche zum Kriminalroman“ (2021).