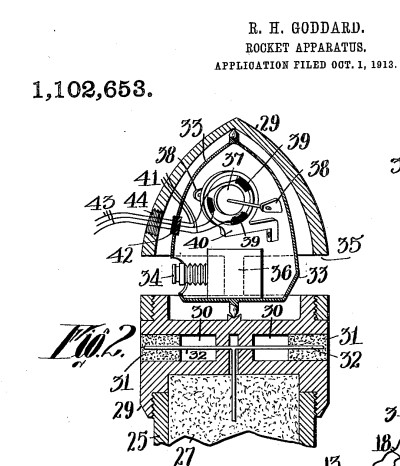Unsere Kolumnistin Christina Mohr beteuert: es ist gar keine Absicht, dass ihr immer wieder geschlechtertrennende Artikel aus der Tastatur fließen – es ergibt sich einfach so. Es ist wie ein Zwang, es gibt kein Entkommen. Erst kümmert sie sich tagelang ausschließlich um Musik und Bücher von und über Frauen, reitet sich richtiggehend in die Materie hinein – um dann festzustellen, dass sich in der Zwischenzeit wahre Berge von Werken männlicher Urheberschaft angesammelt haben. Um die muss sie sich natürlich auch kümmern… und zack, schon wieder ist hier ein Frauentext, dort ein Männertext entstanden… wie dieser hier…
 Wieder da: The Strokes
Wieder da: The Strokes
Mit einem neuen Album der Strokes war nicht wirklich zu rechnen – und so richtig heiß darauf war auch kaum jemand. So bat z. B. ein deutlich gelangweilter Jens Friebe, der die Strokes für Intro interviewen sollte, via facebook um Fragen an die New Yorker Band. Die geposteten Vorschläge machten klar, dass die großen Tage der Strokes vorüber sind; das Interview fand überdies nicht statt. Die bisher erschienenen Reviews sind eher verhalten, einen richtigen Verriss gab es nicht – das wäre auch zu billig, einfach nur Rummeckern und Dooffindenkann ja jeder.
Subtil, aber ätzend wie Nagellackentferner ist hingegen Andreas Borcholtes Rat bei Spiegel Online, die Strokes in dieselbe Liga wie U2, R.E.M. oder AC/DC einzuordnen: die Fans sollten akzeptieren, dass einstmals coole Bands ganz einfach altern und ruhiger/gesetzter würden. Das ist natürlich viel schlimmer als ein Verriss. Denn die Herren Casablancas, Moretti, Hammond und Valensi verkörperten anno 2001 nichts weniger als die Wiedergeburt des Rock’n’Roll mit hübschen Gesichtern und tollen Klamotten. Dank der Strokes waren E-Gitarren wieder in und Rock kein Schimpfwort mehr. Niemand vermochte es besser, den Sound von New York City in knackige, lässige Songs zu packen, zu denen die Mädchen tanzten und die Jungs eigene Bands gründen wollten (und viele taten es: der „The“-Bands-Boom zeugte davon). „This Is It“ ist eine der besten Rockplatten ever, der Zweitling „Room On Fire“ war vielen Fans zu soft, mit Album Nummer drei, „First Impressions Of Earth“ holten sich die Strokes den Siegerpokal zurück.
2005 trennte sich die Band nach internen Krächen und den üblichen Rock’n’Roll-Kollateralschäden, die Strokes-Musiker produzierten Soloalben, die aber den Verlust der Hauptband nicht wett machen konnten. Und jetzt „Angles“: Im Achtziger-Jahre-Cover, Jean-Michel Jarre meets Telex. Die zehn Songs wirken auch nach mehrmaligem Hören so lá-lá, nicht richtig schlecht, aber auch nicht toll. Natürlich kann man Musikern nicht ernsthaft vorwerfen, dass sie weiterhin Musik machen, auch wenn ihre Hochphase länger zurück liegt und die früher so prächtige Lockenmähne allmählich ausdünnt. Man würde von Malern, Schriftstellern, Bildhauern, geschweige denn anderen Berufsgruppen ja auch nicht verlangen, ihre Arbeit aufzugeben, nur weil sie diese schon seit einer Weile ausüben.
Aber man würde doch gern spüren, dass für die neue Veröffentlichung echte Notwendigkeit bestand, und das hört man bei „Angles“ nur an wenigen Stellen heraus. Der Opener „Machu Picchu“ dümpelt im ungewöhnlichen Reggaerhythmus herein, mit „Games“ stellen sich die Strokes selbst ein Bein, das Achtziger-Elektropop-Revival müssen nicht alle mitmachen. „Gratisfaction“ und „You’re So Right“ sind dagegen straighte, dichte, atmosphärische Kracher, The Strokes at their best. Die Single „Taken For A Fool“ wird live ganz sicher prima funktionieren, „Life Is Simple In The Moonlight“ ist sanft und smart, „Two Kinds Of Happiness“ zu sehr auf große Stadien hinkomponiert.
Alles in allem ein wenig unentschlossen resp. „erwachsen“, weil ja, siehe oben, keine Dringlichkeit für nichts mehr besteht und man gemütlich all das mal probieren kann, was früher wegen jugendlichen Ungestüms nicht ging. Nur wenn zwischendurch diese coole, geradeaus nach vorn rennende Gitarre zu hören ist, die einen schlagartig auf New Yorker Asphalt katapultiert, dann… dann will man sofort eine Zigarette im Mund haben und die Tanzfläche stürmen. Aber diese Momente sind wie gesagt selten auf „Angles“, über das die Frankfurter Rundschau headlined, „Rock’n’Roll wird niemals sterben“. Das ist wohl zu befürchten.
The Strokes: Angles. RCA. Die Website der Band. The Strokes auf Myspace und bei Facebook.
 Immer noch da: Rod Stewart
Immer noch da: Rod Stewart
Rod Stewart, gerade 66 geworden, ist eigentlich ein cooler Typ. Leidenschaftlicher Fußballer, Celtic Glasgow-Fan, Ex-Faces-Sänger, Whiskytrinker, Vater von vielen Kindern, (Ex-)Gatte von vielen Frauen… die Liste der Punkte, die einem zu Rod the Mod einfallen, wird lang. Und wir haben noch nicht mal seine legendäre „Reibeisen“-Stimme erwähnt und die vielen, vielen Hits, von denen allerdings nicht alle gut sind. „Sailing“ steht auf der immerwährenden No-Go-Liste der Songs, die niemals und unter keinen Umständen auf Parties gespielt werden dürfen, Roddys Ausflüge ins Disco-Fach wie „Da Ya Think I’m Sexy?“ oder „Passion“ wurden von der Blues-Fraktion unter seinen Fans äußerst argwöhnisch beäugt und sein größter Hit, „Baby Jane“ von 1983 taugt höchstens noch für den Foxtrott-Unterricht.
Stewarts große Stärke liegt in der Interpretation von Songs anderer Leute: seine Version von „Waltzing Matilda“ wurde erfolgreicher als das Original von Tom Waits, auch „Downtown Train“ (ebenfalls ein Waits-Titel), „This Ole‘ Heart Of Mine“, „Ruby Tuesday“ oder „It Takes Two“ im Duett mit Tina Turner gewannen durch seinen unvergleichlichen, kratzigen Nicht-Gesang.
Es war also nicht allzu überraschend, als sich der noch immer stachelhaarige Mister Stewart vor einigen Jahren dem „Great American Songbook“ zuwandte, also klassische US-amerikanische Stücke der Prä-Popära von Komponisten wie George Gershwin sang. Die bisher fünf Alben der „Songbook“-Reihe verkauften sich allesamt prächtig, Stewart wurde für den Grammy nominiert, etc. pp., und natürlich kann er diese Lieder singen, ganz wunderbar sogar. Aber es ist ein bisschen so wie mit Robbie Williams und dessen „Swing When You’re Winning“-Phase: man versteht ja, dass ein Sänger/Musiker nach Herausforderungen sucht, mal etwas ganz anderes machen möchte, sich und seine Stimme in ganz anderem Gewand präsentieren will. Und doch klingt Rod Stewart wie ein Wolf, der Kreide gefressen hat – so ganz nimmt man ihm den weichgespülten „What A Wonderful World“- und „These Foolish Things“-Crooner nicht ab. Die Verbeugung vor dem musikalischen Erbe seiner Wahlheimat (er lebt aus steuerlichen Gründen seit 35 Jahren in den USA) ist respektabel, die Erfolge sprechen außerdem für sich.
Aber trotzdem wünscht man sich nach den vierzehn Stücken von „The Best of… The Great American Songbook“, nach all dem gediegen klimpernden Swing-Jazz mit moderaten Bläsern und Streichern, Stewart würde „HOT LEGS!“ kreischen, auch wenn dieser Song einer seiner peinlichsten ist. Ansonsten taugt „The Best of…“ ganz hervorragend als Ostergeschenk für die Eltern. Oder besser Großeltern.
Rod Stewart… The Best of The Great American Songbook. J Records (Sony). Die Homepage des Künstlers und das deutsche Portal. Rod Stewart bei Facebook und auf Myspace.
 Nicht mehr da: Johnny Cash
Nicht mehr da: Johnny Cash
Johnny Cash cool zu finden ist Ehrensache, oder? Keine Angst, hier soll kein Denkmal demontiert werden – denn bis auf seine streng religiöse Ader und einige drogeninduzierte Ausfälle kann man Johnny Cash kaum etwas vorwerfen, was seine Respektabilität in Frage stellen würde. Im Gegenteil, Cash stand bis zu seinem Tod im Jahr 2003 wie nur wenige andere Künstler für Glaubwürdigkeit und Integrität.
Wie bei so vielen verblichenen Pop-Ikonen tauchen im Lauf der Jahre Tonnen bisher unveröffentlichter Musik auf – so übersteigt das postum veröffentlichte Werk Jimi Hendrix‘ sein zu Lebzeiten herausgebrachtes Material enorm. Johnny Cash hat während seines langen Lebens zwar unzählige Alben veröffentlicht, dennoch lagerten viele private Aufnahmen, erste Demos, etc. im Keller der Sun Studios in Memphis, im Studio House of Cash in Hendersonville/Tennessee und anderswo, die jetzt peu á peu von Columbia/Sony der Fangemeinde zugänglich gemacht werden.
Dem Doppelalbum „Personal File / Bootleg Vol. 1“ von 2006 folgt nun Vol. 2, „From Memphis to Hollywood“, deren Inhalt sich zeitlich ungefähr mit der im Film „I Walk The Line“ dargestellten Frühphase Cashs deckt (1955 bis ca. 1968). Und der Inhalt ist fett: 57 Songs auf zwei CDs verteilt, beginnend mit Radioaufnahmen aus den Fünfzigern über frühe Demos (sehr toll: die rohe „Get Rhythm“-Version), Raritäten aus den Sun Studios bis zu späteren erfolgreichen Songs, die Cash schon als Country-Outlaw präsentieren wie z. B. „The Folk Singer“.
„From Memphis to Hollywood“ ist mehr als ein Kuriositätenalbum für Die Hard-Fans, sondern durchaus ein Best of der frühen Jahre Johnny Cashs, anhand dessen man den Werdegang des gospelsingenden Ex-GIs zum coolen Man in black nachvollziehen kann.
Johnny Cash: Bootleg Vol. 2: From Memphis to Hollywood. Doppel-CD. Columbia (Sony). Der Künstler auf Myspace und bei Facebook. Die Website von Johnny Cash.
 Re-Release, Pt. 1: Phillip Boa
Re-Release, Pt. 1: Phillip Boa
Vor vielen Jahren pflegte mein alter Schulfreund B. Indie-Bands wie die Pixies, Go-Betweens und Phillip Boa & The Voodooclub (man beachte die Mischung) mit dem abschätzig gemeinten Begriff „Mädchenmusik“ zu bedenken. B., ganz lederbejackter Kleinstadtmacho und Hardrockfan, konnte nicht ahnen, dass die von ihm so verunglimpfte Musik auch Jahrzehnte später noch immer viele viele Fans haben würde, auch wenn die damaligen Mädchen längst keine mehr wären.
Phillip Boa & The Voodooclub befanden sich Anfang der 1990er-Jahre auf dem Zenit ihrer Karriere, zumindest qualitativ betrachtet. Seit 1984 veröffentlichte der Club um Ernst Ulrich Figgen (so PB´s bürgerlicher Name) und Pia Lund Jahr um Jahr Alben, mit „Container Love“ vom 89er-Album „Hair“ gelang ihnen ein Riesenhit.
Was aber machte die Musik von Phillip Boa zur „Mädchenmusik“? Vielleicht der herausgespielte Kontrast von Boas grantelnd-schlechtgelaunter Altherrenstimme und Pia Lunds engelsgleich zartem Organ, vielleicht die Soundmixtur aus Indie-Gitarrenkrach und pompösen Refrains. Bis heute klingt der Voodooclub jedenfalls ziemlich einzigartig, auch wenn die letzten Alben nicht an früheren Glanz heranreichen können.
Das scheint auch Phillip Boa selbst zu wissen: seit einigen Jahren werden frühe Platten wiederveröffentlicht, auf der  2006er-„Remastered“-Tour wurden konsequent nur Titel von „Hair“, „Copperfield“ und „Hispanola“ gespielt. Aktuell wurden gerade „Helios“ und „Boaphenia“ re-mastered und mit Bonustracks neu herausgebracht. Die beiden Platten markieren einen Einschnitt in der Laufbahn des Clubs: „Helios“ entstand noch vor Boas Umzug nach Malta (auch wenn schon ein Inselmotiv das Cover ziert) und ist noch stark dem „ursprünglichen“ Boa-Sound verpflichtet, gemixt mit damals sehr angesagten Rave- und Psychedelik-Elementen, was sich z. B. an der Länge der teils regelrecht ausfransenden Songs zeigt.
2006er-„Remastered“-Tour wurden konsequent nur Titel von „Hair“, „Copperfield“ und „Hispanola“ gespielt. Aktuell wurden gerade „Helios“ und „Boaphenia“ re-mastered und mit Bonustracks neu herausgebracht. Die beiden Platten markieren einen Einschnitt in der Laufbahn des Clubs: „Helios“ entstand noch vor Boas Umzug nach Malta (auch wenn schon ein Inselmotiv das Cover ziert) und ist noch stark dem „ursprünglichen“ Boa-Sound verpflichtet, gemixt mit damals sehr angesagten Rave- und Psychedelik-Elementen, was sich z. B. an der Länge der teils regelrecht ausfransenden Songs zeigt.
Das selbstbewusst betitelte „Boaphenia“ (1993) ist das bis dato erfolgreichste Boa-Album und zeigt eine deutliche Hinwendung zur härteren Gangart. Hymnische Refrains und Paar-Duette werden seltener, dafür gibt es mehr ROCK. Zeitgleich zur Veröffentlichung von „Boaphenia“ gründete Phillip Boa das Metal-Bandprojekt Voodoocult, das sich nach zwei Alben wieder auflöste. Die Kolumnistin bekennt, mit Boas Ambitionen auf dem Hard’n’Heavy-Sektor nichts anfangen zu können, von daher auch „Boaphenia“ trotz des zugegeben tollen „Johnny The Liar“ nicht zu mögen.
Mit „Boaphenia“ endete die Beziehung Mohr/Boa, zumindest was den käuflichen Erwerb von Boas Musik anging. „Helios“ steht für glücklichere Tage, mit viel Mädchengesang von Pia Lund und so unvergesslichen Hits wie „30 Men On A Dead Man’s Grave“, „And Then She Kissed Her“ und „Puppets On A Strang“. Trotz alledem: es kann nie schaden, Phillip Boas alte Platten zu hören. Die Ärzte singen in „Wir sind die Besten“, dass es nur zwei gute Bands aus Deutschland gibt. Welche meinen sie wohl?
Phillip Boa And The Voodooclub — And Then She Kis… – MyVideo
Phillip Boa & The Voodooclub: Boaphenia & Helios. Remastered Editions. Vertigo (Universal). Die Homepage der Band. Phillip Boa & The Voodooclub auf Myspace und bei Facebook.
 Re-Release, Pt. 2: Primal Scream
Re-Release, Pt. 2: Primal Scream
Die Gründung von Primal Scream verdankt sich dem Überdruss einer Handvoll junger Männer aus Glasgow an zu vielen älteren Männern von überall. Beziehungsweise, wenn man die politische Situation Englands Mitte der 1980er-Jahre hinzuzählt, auch dem Überdruss an einer sehr britischen Frau namens Margaret Thatcher. Aber hauptsächlich führte die immergleiche Pub-Beschallung, bestehend aus den Stooges, Ramones, Velvet Underground, The Smiths und Bauhaus bei Bobby Gillespie (Ex-Drummer von The Jesus & Mary Chain) und Andrew Innes zu der bitteren Erkenntnis, dass die Tage der Punk-Revolution längst vorbei waren und die durch zu viele 10p-a-pint-hours ins Wachkoma versetzte Jugend sich dumpf und stumpf der körperlich-geistigen Verfettung entgegensoff.
Aber dann kamen die Beastie Boys, drei jüdische weiße Jungs aus NYC, die sich von ihren schwarzen Brüdern den Hip-Hop ausliehen und der stagnierenden Popmusik einen neuen, heftigen Drall versetzten. Und im United Kingdom ging es Schlag auf Schlag: Northern Soul-Allnighter und erste Chicago-House- und Techno-Parties verschmolzen miteinander. Draußen, auf dem Feld, mit mobilen Soundsystems und Partyzelten. Die Jugendlichen tanzten wieder, nächtelang, wochenendenlang. Mit Fischerhütchen und XXXL-Shirts, Trillerpfeifen und jeder Menge synthetischer Drogen: Rave war geboren und dito Primal Scream. Innes, Gillespie und die anderen Jungs der Erstbesetzung (Primal Scream sind bis heute berühmt-berüchtigt für ihr Personalkarussell – einziges konstantes Mitglied: Bobby Gillespie) spürten, dass die neue musikalische Revolution gekommen war und Punk endgültig begraben werden konnte.
Primal Scream setzten zunächst auf wabernd-schlingernde Psychedelik-Gitarren, die unverfälschte Ursprünglichkeit ausdrücken sollten, ihren magic moment aber fanden sie mit ihrem zweiten Album „Screamadelica“, über das der NME schrieb, es habe „die Musik für immer verändert.“ „Screamadelica“ wird heuer zwanzig Jahre alt, was Sony Music eine remasterte Deluxe Edition wert ist: dem Album liegt die EP „Dixie Narco“ bei, drei Songs davon waren auf dem Originalalbum nicht enthalten. „Screamadelica“ ist auch heute noch ein echtes Erlebnis, die Mischung aus Psychedelica, Gospel, Rave, Sitarklängen und frühen House-Elementen macht ergriffen und enthemmt, und auch ganz ohne Pillen bekommt man glänzende Augen. Tanzen will/muss man sowieso. Der Opener „Movin‘ On Up“ wirkt noch immer so erhebend wie damals, als man ihn zum ersten Mal in der Indie-Disco hörte, „Loaded“ mit seinem Spoken Word-Intro ist auch heute noch eine ziemlich gewagte Nummer, und das in der Mitte des Albums platzierte „Come Together“ ist mit zehneinhalb Minuten Länge ein Klang gewordener Trip. „Screamadelica“ sagt dir, dass der Club/die Disco deine Kirche ist und der DJ dein Gott. Und Bobby Gillespie der teacher & preacher.
Primal Scream: Screamadelica 20th Anniversary Deluxe Edition. 2 CDs. Sony. Die Website von Primal Scream. Die Band bei Facebook und auf Myspace.
 Die Kassette als Klischee: „Kassettendeck“ von Jan Drees und Christian Vorbau
Die Kassette als Klischee: „Kassettendeck“ von Jan Drees und Christian Vorbau
Kommt, lasst uns auf ein paar Klischees herumreiten, z. B. dem, dass das Aufnehmen von Mixtapes auf Cassetten in den 1980er-Jahren ein typisches Jungsding war. Die Verfasserin dieser Zeilen widerlegt das sofort mit dem Verweis auf die -zig Schuhkartons mit eigenhändig aufgenommenen Cassetten in ihrem Keller. Natürlich mit selbstgestalteten Covern.
Die Lektüre von „Kassettendeck“, dem hübsch aufgemachten, von Romanautor Jan Drees und Indie-DJ Christian Vorbau herausgegebenen Reader, bestätigt hingegen das Klischee vom mixtapenden Jungen und mixtapegeschenktkriegenden Mädchen: ganze fünf Frauen stehen den Herausgebern Rede und Antwort – und knapp dreißig Männer. „Kassettendeck“ ist, der Untertitel „Soundtrack einer Generation“ verrät es schon, eine zu weiten Teilen schwer nostalgische Rückschau auf die Vergangenheit, die sich wie so oft in letzter Zeit in den achtziger Jahren befindet. Drees und Vorbau variieren allerdings das beim Thema Pop-Memoiren so beliebte Anthologie-Format, in dem sie Interviews, Essays, Listen, subjektive Geschichten und sachliche Info-Texte aneinanderreihen. Auch anders als in anderen Büchern: die aufgeführten Musiker, DJs, Journalisten schreiben ihre Story nicht selbst, sondern Drees/Vorbau schreiben über sie und flechten O-Töne ein.
So erfährt man im Text über den Ostberliner Schriftsteller und Radio-DJ Ronald Galenza, wie sich Jugendliche in der DDR mit neuer Musik (bevorzugt aus dem Westen) versorgen konnten; man bekommt Benjamin von Stuckrad-Barres These von 1995, „Jungs haben mehr Platten und CDs als Mädchen“ noch einmal nacherzählt, und es gibt ein längeres Kapitel über den Walkman. Alexa Hennig von Lange gesteht im Interview, dass sie „Kuschelrock 1“ mit dem Aufnahmegerät ihres Papas kopierte; der Artikel „Liebe ist eine Mixkassette“ referiert aktuelle Buchveröffentlichungen zum Thema Mixkassette. Auf den Seiten 121 – 123 befindet sich eine Zahlen- und Faktensammlung zur Kassette, und wer wissen will, was „American Psycho“-Autor Bret Easton Ellis auf ein Mixtape packen würde, kann das ab S. 149 nachlesen.
Drees und Vorbau gehen mit „Kassettendeck“ auf große Lese- und Partytournee, dazu gibt es ein Tourblog (kassettendeck.info) – klar, was Männer anpacken, machen sie richtig. Noch so ein Klischee…
Jan Drees, Christian Vorbau (Hg.): Kassettendeck. Soundtrack einer Generation. Eichborn, Frankfurt 2011. Klappenbroschur, 253 Seiten. 18,95 Euro.
 Klischeefrei, aber deprimierend: Rocko Schamonis „Tag der geschlossenen Tür“
Klischeefrei, aber deprimierend: Rocko Schamonis „Tag der geschlossenen Tür“
Schon vor ein paar Monaten veröffentlicht, aber immer wieder eine Empfehlung wert: Rocko Schamonis klischeefreier Herrenroman „Tag der geschlossenen Tür“. Sein Antiheld Michael Sonntag ist seit „Sternstunden der Bedeutungslosigkeit“ ein wenig gealtert, was an seiner ambitionslosen Lebensgestaltung nichts geändert hat. Er pflegt sein L’Art-pour-L’Art-Talent als Namenserfinder („Dr. Baby Rabottnik Sazauer“, „Opa Palumba“), stellt sich selbst als Museumswärter ein und schreibt Kolumnen für eine Zeitung, obgleich er das Kolumnenschreiben hasst. Er verrennt sich in die aussichtslose Liebe zu einer O2-Shop-Verkäuferin, lässt sich von seinem Kumpel Novak zu sinnlosen Geschäftsprojekten überreden und verfällt nach dem Besuch bei seiner Oma im Seniorenheim in tiefe Depressionen. Zuweilen stürzt er sich in erotische Abenteuer, die seine Selbstverachtung und Beziehungsunfähigkeit aber nur noch verstärken.
Kurzum: ein zutiefst tragisches Buch, das seinem Autor zu viele Lacher an der falschen Stelle beschert. Das weiß Rocko Schamoni selbst am allerbesten und schreibt wahrscheinlich schon am gewiss noch deprimierenderen Nachfolger zu „Sternstunden…“ und „Tag der geschlossenen Tür“.
Rocko Schamoni: Tag der geschlossenen Tür. Piper: München 2011. Taschenbuch, 270 Seiten. 16,95 Euro. Die Homepage von Rocko Schamoni. Der Künstler auf Myspace sowie bei Facebook.
Christina Mohr