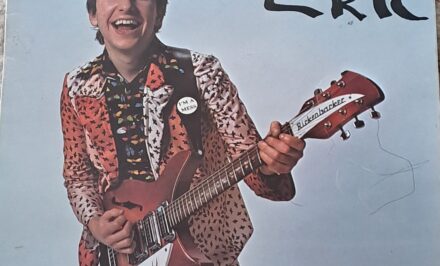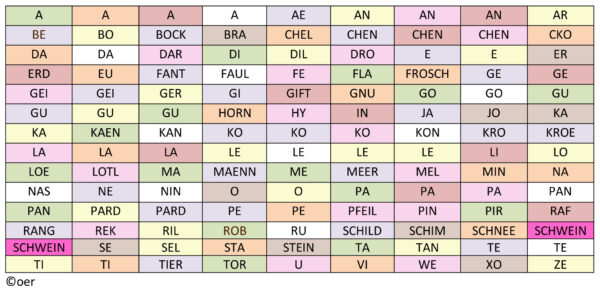Trauerspiel einer Selbstdemontage
Trauerspiel einer Selbstdemontage
– Joachim Feldmann war auf dem Konzert eines wirklichen Altmeisters des Rock – Bob Dylan. Sein Bericht fällt allerdings etwas ernüchternd aus…
Seit er am 25. Juli 1965 das Publikum beim Newport Folk Festival mit einer elektrischen Gitarre und dem geballten Sound der Paul Butterfield Bluesband schockierte, hat sich Bob Dylan wahrscheinlich daran gewöhnt, dass immer mal wieder Zuschauer entnervt aus seinen Konzerten fliehen. Es wird ihn also nicht sonderlich beeindruckt haben, als bei seinem Auftritt in Oberhausen am 23. Oktober ältere Herrschaften in Massen den Ausgängen zuströmten. Glaubt man den Erklärungen der professionellen Berichterstatter, handelte es sich vor allem um Fans von Mark Knopfler, der den ersten Teil des Konzertes mit perfekt gefertigtem, aber nicht sehr aufregendem Folkrock bestritten hatte. Im Anschluss an diese gefällige Darbietung sei Dylan offenbar als zu laut und zu heftig empfunden worden.
Und schon schlägt die Stunde des wahren Kenners. Wer sich auf „einen gemütlichen Nostalgieabend mit einem jovialen Onkel Dylan in Best-of-Laune“ gefreut habe, sei eben auf dem vollkommen falschen Dampfer gewesen, spottet zum Beispiel Eric Pfeil in der FAZ, um dann großspurig zu erklären: „Es sollte sich doch eigentlich längst herumgesprochen haben: It Ain’t Me, Babe.“
Ähnliches habe ich selbst wahrscheinlich auch mal gedacht, als nämlich 1978 bei des Meisters erster Deutschland-Tournee etliche enttäuschte Folkies die Dortmunder Westfalenhalle verließen, weil ihnen „Don’t Think Twice“ in einer Reggae-Fassung oder „Masters Of War“ im Hard Rock-Gewand nicht zusagten. Leute eben, wie wir in jugendlicher Arroganz meinten, die irgendwie verpasst hatten, dass Dylan schon seit mehr als einem Jahrzehnt nur noch gelegentlich zur Akustikgitarre gegriffen hatte.
Aber zurück nach Oberhausen. Dass die Stimme nach einem halben Jahrhundert auf der Bühne nicht mehr richtig will, konnte man ja schon auf den letzten Platten des Herrn Zimmermann hören, was aber an jenem Sonntagabend aus den Boxen kam, lässt sich nur noch als Krächzen beschreiben. Von einem „Rock’n’Roll-Gespenst“ schrieb ein Journalist am nächsten Tag und meinte das offenbar als Kompliment.
Wir sind natürlich nicht gegangen, sondern haben uns das Spektakel bis zum abschließenden „Like A Rolling Stone“ angeschaut. Hören durften wir unter anderem eine verhauene Version von „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“, ein durch die Mangel gedrehtes „Waching The River Flow“ und eine bemerkenswert geradlinige Fassung von „Highway 61“. Aber so richtig gut war das alles nicht, und schon gar nicht „großartig“, wie Eric Pfeil meint.
Den rotzigen Rocker zu geben, gelang Bob Dylan auch in den sechziger Jahren problemlos. Ob während seiner England-Tournee 1966 oder zwei Jahre später bei den Aufnahmen mit The Band, die dann als „Basement Tapes“ erschienen: Der Meister ließ es auch damals gerne krachen. Und was er in Oberhausen bot, war strukturell nicht sehr weit davon entfernt. Aber die Stimme macht halt nicht mehr mit. Und über das Gefummel auf der elektrischen Orgel, anscheinend sein neues Lieblingsspielzeug, sagt man am besten gar nichts.
Für all das lassen sich schöne Sprachbilder finden. Dylan klinge „wie ein durchtriebener Hochzeitsmusikant, der sich zwar an die Liste mit den Wunschsongs hält, sich deren Interpretation aber vorbehält“, manchmal aber auch „als würde Helge Schneider in Las Vegas düstere Bluesrock-Exorzismen aufführen“ (wieder Eric Pfeil). Dass es sich bei all dem um das Trauerspiel der Selbstdemontage eines großen Musikers handelt, wäre vielleicht nicht so originell, aber dafür deutlicher formuliert. Er darf das machen, keine Frage. Aber ich muss dabei nicht mehr zusehen.
PS: Es gibt eine Theorie, nach der die Zwischenrufe 1965 in Newport zunächst weniger mit Dylans Elektrogitarre zu tun hatten – die konnte man erwarten, schließlich war „Like A Rolling Stone“ frisch in die Charts gelangt –, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass seine Stimme aufgrund eines Mikrofehlers nicht zu hören war. Dass die Legende es lieber anders hätte, ist verständlich.
Joachim Feldmann