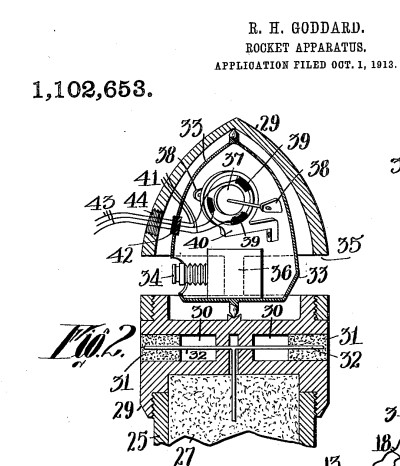12 Sachen, gehört
Milton Henry: Rastafari Cannot Die / Branches And Leaves Dub
Milton Henry verstarb bereits am 3. Dezember 2022. Krebs. Mitgekriegt habe ich das erst Anfang Januar, als die Roots-Reggae-Sendung Shocks of Sheba auf KBOO Portland dem 72-jährigen Arrangeur, Komponisten und Sänger mit einer Stimme wie frisch gebutterter Toast Tribut zollte. Ich suchte diese Maxi raus. Sie war schon ziemlich durch.
Robert Forster: Tender Years
Das coolste Mitglied der eh recht coolen Go-Betweens schreibt ein Liebeslied an seine Frau nach ihrer überstandenden Chemotherapie und fasst sie so zusammen: »She’s a book of a thousand pages that you can‘t thumb.« Im Video dazu steht der 64-Jährige in der gemeinsamen Küche, bereitet Müsli mit frischer Papaya zu (und bringt später ein eigenes Müsli namens »Spring Grain« auf den Markt), tanzt ungelenk und spielt Luftgitarre wie ein Pubertierender. Choreografie? Genau, Karin Bäumler, seine Frau.
Piratensender Powerplay
So wie es wohl mehr Schreiber als Leser gibt, gibt es vermutlich auch mehr Podcaster als Zuhörer. Aus dem Überangebot ragt dieser in diesem überheißen und kriegerischen Drecksjahr massiv hervor. Samira El Ouassil und Friedemann Karig, die schon das erhellende Sachbuch »Erzählende Affen« geschrieben haben, beackern und sezieren wöchentlich aktuelle Diskurse und Dilemmata. Sie sind dabei auf eine kleinlaut machende Art klug und haben immer mehr gesehen, gehört und gelesen, um die Politik der FDP, das Nichtstun im Angesicht der Klimakatastrophe oder das Wischiwaschi des Bundespräsidenten zu attackieren. Und wenn sie nicht weiterwissen, laden sie sich tatsächliche Experten wie Richard C. Schneider (»Die Sache mit Israel«) ein und geben denen nicht nur eine Stunde Zeit, sondern gehen auch davon aus, dass ihr Gesprächspartner Recht haben könnte.
Drei Minuten ruppiges Aufbrausen darüber, dass es entgegen aller Politiker-Versprechen nichts besser wird, sondern – Überraschung! – nur schlimmer. Das Video dazu ist eine Mixtur aus Bruegel’schem Wimmelbild und vor Wut kotzender Dada-Collage mit vielen UK-Arschlöchern. In einer Rezension hieß es über diesen Song: »angenehm angepisst«. Trifft es ziemlich genau.
Rogê: Existe Uma Voz
Eine Hymne aufs Schlauerwerden als skelettierter Bossa-Nova-Funk, der klingt, als wäre er aus den 60er Jahren in unsere Gegenwart geplumpst. Produziert vom Multi-Instrumentalisten Thomas Brenneck, der die lässig groovende Menahan Street Band gründete, die wiederum ausdauernd von Jay-Z oder Kendrick Lamar gesamplet wurde. Da man das alles unterschwellig hört, hätte »Existe Uma Voz« eigentlich ein Sommerhit werden müssen.
Astrud Gilberto: All I’ve Got (Jack Tennis Edit)
Ob der Bossa Nova auch ohne ihre Stimme ab den späten Fünfzigern die Welt erobert hätte? Auf jeden Fall. Aber mit ihrer kühlen, atemlosen Stimme war es einfacher. Und sie besaß darüber hinaus einen wohl sehr eigenen Kopf, arbeite mit João Gilberto, Stan Getz, Quincy Jones, George Michael and James Last. Aus Anlass ihres Todes im Juni fummelte ich »That Girl from Ipanema« aus dem Archiv, ihr Album von 1977, auf dem Samba, Cool Jazz, Philly-Soul und Disco sich die Ringe reichen und auch obiger Song findet – immer noch groß und mehrmals remixed.
Saeko Killy: Sun Shower
Was für Musik macht eine Japanerin, die im Alter von vier Jahren ans Klavier gesetzt wurde? Deren Eltern Jazz und Brazil mögen?
Die später in Tokio auf Techno-Parties landete? Dann nach Berlin zog, dort die Industrial-Sounds von Cabaret Voltaire und Throbbing Gristle schätzen lernte? Logisch: Leicht vernebelt-verhallten Rumpel-House, großartig genug, um sein Bier abzustellen und tanzen zu gehen.
Manchmal entsteht der Eindruck, die 24-Jährige hätte das Jungle-Revival allein gestemmt, so präsent ist die in London lebende Halb-Jamaikanerin. Stimmt ja vielleicht auch. Dieser Song, der gute Argumente dafür einfordert, warum man nicht einfach gehen sollte, ist eine eher souverän zerdehnt gesungene Mischung aus so dickem wie melodiösem Basslauf, zuckrigen Streichern und Hip-Hop-Beats in Hochgeschwindigkeit. Wer damit warm geworden ist: Es gibt auch ein einstündiges, soulig-treibendes Baller-Set in der Radio-Station »The Lot«.
Guiding Star Orchestra: Communion
Aus Kopenhagen stammender instrumentaler Dub-Reggae, hard hittin‘ mit vom Cool Jazz inspirierten Bläsersätzen – klingt ein bisschen, als wolle man unbedingt mit Absurdem punkten. Aber das elfköpfige Kollektiv erfindet überhaupt nichts Neues (weitere Anspieltipps: das Album »Below The Bassline« von Ernest Ranglin aus dem Jahre 1996 oder die Reihe »In Jazz, The Dub Is Everything« auf Mixcloud), dies aber so schläfrig, so symmetrisch, so sämig und mit kleinen Irritationen, dass man denkt, es erklingt der Soundtrack für den Shop eines Bauhaus-Museums.
Alexander Skrjabin: Klavierkonzert fis-Moll op. 20 (Moscow Symphony Orchestra, Klavier: Konstantin Scherbakov, Leitung: Igor Golovschin)
Die knallbunte Arte-Serie »Nackt über Berlin« um zwei 17-Jährige, Fetti und Fidschi genannt, die sich gegen Mobbing und mehr zur Wehr setzen, setzt klassische Musik von Rachmaninoff, Satie oder Tschaikowski als Score ein wie alle anderen sonst Pop oder Auftragsgewaber. Was mich veranlasste, diese mal lyrisch zart fließende, mal wogend pompöse und Chopins Klavierkonzerte hinter sich lassende knappe halbe Stunde aus dem Schrank zu holen. Wenn schon Nostalgie, dann richtig und weder Beatles noch Stones.
DJ Koze w/ Sophia Kennedy: Wespennest
Wespennest? Kenn‘ ich, hatte ich schon unter dem Dach. Mit der Zeit merkt man: Die tun nichts. Anders als dieser Track: Acht Minuten deep bangender House vom »Beethoven der Ableton-Produktion«, wie Róisín Murphy ihn nennt, die einen sirrend umkreisend wie ein Insektenschwarm. Dazu singt Sophia Kennedy zumindest mich an Hildegard Knef erinnernd: »Du-du-durch die Fensterscheibe sehe ich die Bäume / die schleichend aufs Neue sanft erblüh’n.« Und weiter: »Der Anfang steht schon fest: Erst die Knospe, dann der Rest.« Nach dem süßen Start und der bitteren Vorahnung: »Ein leises Rumoren aus dem Wespennest.« Leben eben.
Panda Bear & Sonic Boom: Danger / Danger (Songbook Instrumental) / Danger Dub
Zwei Musiker, der jüngere (Panda Bear von Animal Collective) aus dem Milieu progressiver Rockmusik, der ältere (Sonic Boom von Spaceman 3) aus dem Milieu zugedrogter Miniaturen, arbeiteten 2022 zusammen. Ihr Song »Danger« fließt träge so vor sich hin wie ein renaturierter Kanal im Ruhrgebiet. Mit einem Sample von den Everly Brothers. Und mit elastischem Gesang, als säßen die Beach Boys am Ufer und starrten im Altweibersommer auf fallende Blätter: »Dang dang dang dang / dang dang dang / I’m in danger«. Dub-Legende Adrian Sherwood machte dann daraus eine Reggae-Version mit etwas höherem Wasserstand, eine Truppe Bläser und ein Gitarrist gesellen sich am Ufer dazu, während Biber einen Damm bauen und alles langsam absperren, aufstauen. Vintage-Musik, ver-rückt.
12 Sachen, gesehen
The Banshees of Inisherin
Ach, diese Männer. Wir schreiben das Jahr 1923, in Irland ist Bürgerkrieg, doch auf einer kleinen Insel kriegt man davon wenig mit. Colin Farrell und Brendan Gleeson (zum ersten Mal wieder vereint seit »Brügge sehen… und sterben?«) sind ziemlich beste Freunde – bis Gleeson, der Ältere, einfach keine Lust mehr darauf hat, lieber komponieren und Geige spielen will als gemeinsam zu saufen, ein wenig so wie Melvilles Bartleby. Allerdings geht es nicht ums Nichtstun, sondern das Gegenteil: Der naive Farrell wird aufdringlich, Gleeson wehrt sich mit Gewalt, auch gegen sich selbst. Vor einer Kulisse aus Wiesen, Felsen und dunklem Meer, so schroff und schön, dass man sofort umziehen möchte, inszeniert Regisseur Martin McDonagh (»Three Billboards Outside Ebbing, Missouri«) ein erdiges, schrulliges, schwarzhumoriges und schließlich verzweifeltes Duell aus Nichtverstehen sowie unterdrückten und gekränkten Gefühlen, an deren Ende die schlauste Frau flieht. Ach, diese dummen, dummen Männer …
Kill Boksoon (Netflix)
Wieder ein Meisterwerk aus Korea. Was anfangs daherkommt wie ein klassisch blutspritzender Action-Film um einen Killer, der aus dem Geschäft aussteigen will, aber nicht darf, ist eher eine so sorgfältige wie blutige Analyse, warum die Kombination aus alleinerziehender Mutter einer pubertierenden Tochter und gleichzeitiger Karriere gesellschaftlich nicht funktioniert – und dies mit Twists, deren Schauwerte stets inhaltlich begründet sind. Jenseits aller Klischees sind auch die Kampfszenen inszeniert: Mal komplett als Schattenriss gefilmt, mal als epische Vorahnung, mal durch einen fahrenden Zug hindurch und mal allein als Spiegelung in einer Regenpfütze.
Barocco (Thalia Theater, Hamburg)
Eine Mixtur aus Pathos, Pomp und, vor allem, Politik als Statement für ein besseres Leben – und sei es, dieses per Freitod zu erringen. Der Anfang: Ein Elektriker erklimmt im Gewitter eine Laterne, um sie zu reparieren – beobachtet von einer Menge mit schwarzen Schirmen – und stirbt. Das Ende: Ein Musiker sitzt am Flügel und spielt mit links Bachs Chaconne in d-Moll, während seine rechte Hand an einen Wärter gekettet ist. Dazwischen ist in dem mehr als zweistündigem Stück, wie so oft bei Kirill Serebrennikov, alles möglich. Für mich persönlich zu viele Anspielungen von Jan Palachs Selbstverbrennung in Prag 1969 über »American Beauty« bis zur Letzten Generation, zu viel Durcheinander von Oper, Rock, Ballett, Revue, Videokunst und überbordenden Theatertricks. Aber eben auch eine flammende Hymne auf die künstlerische Freiheit. Und warum nicht mal alles auf Barock setzen, dieser Ästhetik des schönen Anderen, des Wohlklangs und der Widersprüchlichkeit? Warum nicht einfach mal Perlen kotzen?
Terry Moore: Parker Girls (Abstract Studio)
Unanständig ausgepresste Erzähl-Universen – »Batman«, »Star Wars«, Marvel, you name them, und »Mattel« naht mit großen Schritten – gibt es genug. Comic-Zeichner Terry Moore hat sich und uns ein ganz eigenes erschaffen. Mehrere tausend schwarz-weißer Seiten umfasst sein Werk um das lesbische Paar Katchoo und Francine (»Strangers In Paradise«), in dem zwar alles miteinander zusammenhängt, er aber gleichwohl mal Richtung SF abzweigt (»Echo«), mal Richtung Horror (»Rachel Rising«), mal auch die Trauma-Bewältigung von Soldatinnen (»Motor Girl«) thematisiert, und, vor allem, nahezu jede Serie so enden lässt, dass die klare Auflösung kurz und großartig an die Wand gefahren wird. In den zehn Heften der »Parker Girls« geht es mehr um Morde, Satellitennetze und eine bösartige Kreatur, als hätten Mark Zuckerberg und Elon Musk ein Kind gezeugt, als um Liebe oder Humor, aber das ist egal: Es ist ein neuer Terry Moore. Und alles hängt mit allem zusammen, sowieso.
Das Lehrerzimmer
Das Perfide an diesem Film ist, dass man alle Figuren versteht. Die junge Lehrerin Carla Nowak (nur enorm: Leonie Benesch), die an das Gute im Menschen glaubt und aufklären will, wer an dieser Schule klaut. Die des Diebstahls Angeklagte, die die Tat jedoch leugnet. Deren Sohn, der in der Klasse von Nowak sitzt und sich mit seiner Mutter solidarisiert. Das mal überforderte, mal genervte Kollegium, dessen Alltagsabläufe durch rebellierende Schüler gestört werden. Die Redaktion der Schülerzeitung, deren Anklagen, was in der Schule falsch läuft, trotz des Mottos Veritas omnia vincula vincit in einer übertriebenen und fehlerhaften Wandzeitung enden. Die aufgebrachten Eltern, die sich über WhatsApp organisieren und Nowak auf einem Elternabend attackieren. Die Schulleitung, zwischen Fürsorgepflicht und Behörde zerrieben. Der genau beobachtete, sich ausweglos steigernde und beklemmend eng gefilmte Film von İlker Çatak zeigt, wie sich Gesellschaft formt. Und stellt die simple Frage: Na, wo stehst Du?
Ted Lasso (Apple tv+)
Es war die sonnenblumenhafteste Serie der letzten Jahre. Vielleicht überhaupt. Sie kam an ein Ende. Ooder auch nicht. Wie auch immer, das Comedy-Drama um den US-Trainer Ted Lasso, der den mittelmäßigen AFC Richmond in der britischen Premier League übernahm, keine Ahnung von Fußball hatte, aber sehr viel von Freundlichkeit und Optimismus, war ein Märchen, welches die zynische Realität des Geschäftemachens niemals aussparte. Danke dafür.
Hardly Working
Als der Begriff NPC als Vorschlag in der Wahl zum Jugendwort 2023 auftauchte, ich so: Hä? Also fragte ich. Ein junger und geduldiger Pädagoge erklärte es. Non playable character. Figuren also, die in Videospielen im Hintergrund immer und immer dasselbe tun, ewig dieselben zwei Nägel einschlagen oder stundenlang den Boden fegen, so was. Virtuelles Proletariat also, das keine Fortschritte erzielt. Inzwischen ist NPC aber auch ein Synonym für Mitläufer. Dann zeigte er mir diesen 20-minütigen entschleunigten Essayfilm von der selbsternannten pseudomarxistischen Medienguerilla Total Refusal, der sich ethnologisch vier NPCs in dem Computerspiel »Red Dead Redemption 2« widmet. In dem ironisch-philosophischem Voice-over wird etwa entdeckt, dass die NPCs jeden Konsum verweigern und nicht im Traum daran denken, sich selbst zu optimieren. Die Frage sei also: Ein Glitch, ein Fehler im System? Oder schon Aufstachelung zum Widerstand?

Tom Gauld: Die Rache der Bücher (Ü: Christoph Schuler; Edition Moderne)
Seit 17 Jahren zeichnet der Schotte Tom Gauld jede Woche einen Cartoon für den Guardian. Meist geht es um Literatur. Beispielsweise so, das perfekte Rezept einer KI für den Weihnachtsbestseller: »Ein abgehalfteter Influencer besucht inkognito eine Kochschule für Zauberer, um einen Serienmörder zu fangen, der täglich meditiert, und lernt dabei, nahrhaftes, preisbewusstes Essen aus dem Nahen Osten zu kochen.« Oder so, fragt ein Kunde in der Buchhandlung: »Können Sie mir einen dicken, seriösen Roman empfehlen, den ich rumtragen und ignorieren kann, während ich am Handy bin?« Oder so: Auf dem ersten Bild steht »Short Story«. Auf dem zweiten fragt ein Autor den Verleger, ob er dessen Kurzgeschichten veröffentlichen will. Die knappe Antwort: »Nein.« Auf dem dritten steht dann »The End«. So geht das Seite für Seite – wer da nicht bittersüß lacht, hat kein Herz.
Everyone’s is f*cking crazy (ARD)
Die Therapeutin springt aus dem Fenster – und vier ihrer Klienten gründen zwar widerwillig, aber notgedrungen eine Selbsthilfegruppe. Eine davon ist gerade in ihrer manischen Phase, eine hat ihre Aggressionen so überhaupt gar nicht unter Kontrolle, einer weder seinen Drogenkonsum noch seine Intelligenz (»Camus hat uns alle verarscht«), während die Vierte auf eine extrem komplizierte Weise gehen muss, damit niemand verletzt wird, den sie liebt. In acht knappen Folgen gelingt dieser rasant geschriebenen, hochgradig gespielten und einfallsreich gefilmten Serie etwas Großartiges: Man entwickelt enormes Mitgefühl für dieses traumatisierte Quartett und lacht zugleich mit ihnen, nie aber über sie.
Was ist Kunst, Irwin? (Dortmunder U)
Irwin ist ein slowenisches Künstlerkollektiv und beantwortet in dieser Retrospektive ihres 40-jährigen Schaffens im Vorbeigehen eine der schwersten Fragen. Kunst ist Staatskunst – wenn man denn einen Staat gründet, der ohne Territorium nur in der Zeit existiert, mit temporären Botschaften und eigenen Pässen und dessen größte Gruppe an Staatsbürger:innen aus Nigeria stammt. Kunst ist es, Rahmen vorzugeben – in dem dann vielleicht mehrere weitere Rahmen sind, vielleicht gar nichts ist, der vielleicht auch an allen vier Ecken an Landschaftsgemälden befestigt ist. Kunst ist ein Markt – wenn man ein Foto mit Marina Abramović produziert, drei Abzüge herstellt, diese von Abramović, vom Fotografen und vom Kollektiv selbst signieren lässt und sich an den unterschiedlichen Preisentwicklungen erfreut. Kunst ist auch schwarzer Humor – wenn man etwa das Schwarze Quadrat von Kasimir Malewitsch von 1915 aus Legosteinen nachbaut oder so verwischt malt, als stamme es von Gerhard Richter. Kunst ist aber auch toll hilflos – wenn man etwa die Staatsmacht provozieren will, die aber einfach nicht reagiert. Kunst, so kann man diese Ausstellung also zusammenfassen, Kunst zerlegt. Vorstellungen, Identitäten und, selbstverständlich, sich selbst.
Auf der Adamant
Die »Adamant« – zu deutsch: die Unnachgiebige – ist eine am Ufer der Seine vertäute psychiatrische Tagesklink. Das aber erfährt man erst im Abspann. Beginnen tut die Dokumentation über dieses Schiff mit einem fast zahnlosen Mann, der später erzählt, dass er ohne starke Medikamente ausrasten würde, und der den Song »La Bombe Humaine« der New-Wave-Combo Téléphone intoniert. »Die menschliche Bombe, du hältst sie in deiner Hand«, singt er, immer wütender werdend, »Du hast den Zünder direkt neben dem Herzen.« In dieser Art geht es ohne jede Einordnung kaum aushaltbare zwei Stunden weiter: Regisseur Nicolas Philibert hält ohne Erklärung oder Kommentar direkt drauf. Auf zerfurchte Gesichter, Tics, wirre Redeflüsse – einer hält sich für die Wiedergeburt Van Goghs, eine hört Stimmen und musste deshalb ihren Sohn an eine Pflegefamilie abgeben – und dramatische Schicksale, die in Malerei, Musik und Hilfsarbeiten Stabilität finden, Helden sind für einen Tag. Die Adamant, sagt die Psychiaterin, die kurz nach den Dreharbeiten die Leitung übernahm, sei ein »Wunschort«, da alle dort seien, weil sie dort sein wollen. Man kann nur hoffen, dass das stimmt.
The Killer (Netflix)
Es gibt drei, vier Punkte, die richtig toll sind. Die eitrig gelbe Farbgebung etwa, die Smiths-Songs, überhaupt die ersten zwanzig Minuten, in denen der namenslose, ausgemergelte Auftragsmörder (Michael Fassbender) nahezu regungslos in Paris auf sein Opfer wartet und sich dabei monoton Glaubenssätze vorträgt wie »zweimal messen, einmal schneiden«. Dann trifft das Ziel ein, der Killer allerdings daneben. Ab da verlässt Regisseur David Fincher die Comic-Vorlage von Jacamon und Matz, die er doch seit Jahren schon umsetzen wollte. Und damit leider auch jede Emotion, jede Opulenz, jede moralische Erörterung, all das, was im Original zentral war. Stattdessen soll man nun einem Menschen folgen, dessen Psyche eine Art Trutzburg oder auch ein schwarzes Loch ist, der sich stets nur fragt, was für ihn drin sei. Man kann und soll das vermutlich kritisch sehen, Atomisierung des Individuums, Kritik der Übertragung des Wachstumsprinzip ins Persönliche, römmpömmpömm, die Ödnis des Action-Films an sich oder auch als Zeichen der kapitalistischen Zeit. Aber irgendwie bleibt das lahm. »The Killer«, dies nur nebenbei, hieß auch ein Film von John Woo aus dem Jahr 1989, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Derzeit produziert Woo das Remake. Es bleibt also Hoffnung. Was auch sonst, in so einem, ich glaube, ich erwähnte es schon, überheißen und kriegerischen Drecksjahr. Wobei, das sagt ausgerechnet ein russisches Sprichwort: »Wer zu viel hofft, der irrt sich oft.«
Daher sieben kleine Sachen, nur erfreulich
- Wenn Verlierer gewinnen: »Slow Horses«
- Samova-Tee »Saint Peter’s«
- FC St. Pauli
- Maison Gainsbourg, Paris
- https://splendido-magazin.de/
- WDR Cosmo
- Stolze 40 Bittereinheiten: Störtebeker Atlantik Ale AF
5 weitere Sachen, noch auf dem Stapel
Warum Leonard Cohen Klarheit und Zuversicht im Yom-Kippur-Krieg gewann: Matti Friedman »Wer durch Feuer« (Hentrich & Hentrich)
Das Kap der guten Hoffnung inspiriert das Land der aufgehenden Sonne mit seinen Beats: Audiot 909: »Japanese Amapiano«
Lesebändchen, mit denen man schießen kann: Edward Brooke-Hitchings »Bibliothek des Wahnsinns« (Knesebeck)
Robert DeNiro mal nicht zerknautscht, sondern böse: »Killers Of The Flower Moon«
Eine Rezension in der britischen Literary Review verriet, dass die gute Nachricht die ist, dass wir verdammt sind. Und die noch bessere, dass wir nichts dagegen tun können: Peter Frankopan 1024 Seiten Klima-Geschichte »Zwischen Himmel und Erde« (Rowohlt)
12 Sachen, gelesen
Sara Gran: The Book Of The Most Precious Substance (Dreamland)
Inmitten ihrer berauschenden Claire-DeWitt-Reihe schreibt Gran über die Suche nach einem magischen Werk aus dem 17. Jahrhundert, welches unbegrenzte Macht und unvergleichlichen Sex verspricht. Bücher über Bücher: Für mich klingt das immer nach Angstblüte. Aber hier passt es, denn Lily Albrecht, eine Frau in den Vierzigern, deren große Liebe nur noch sabbernd im Rollstuhl vegetiert, kommt ihrem Übersehenwerden durch Jagd zuvor. Enttäuschend ist der strukturelle Aufbau: Bis die Suche zu etwas anderem führt als Klischees des dekadenten Lebens (Kurztrips in hippe Metropolen, Villen mit hohen Decken, Champagner) dauert es mehr als 200 Seiten. Erfreulich aber, dass immer wieder Grans Größe und Härte durchblitzt. Das Elend der Care-Arbeit ist zudem dermaßen einfühlsam und brutal und wie selbsterlebt beschrieben, dass sich der Respekt vor pflegenden Personen potenziert. Und die Moral zudem ist nicht schlecht: Hört besser auf erfahrene Hexen!
Georgi Gospodinov: Zeitzuflucht (Ü: Alexander Sitzmann, Aufbau)
Putin träumt vom Großrussland, Erdoğan vom Osmanischen Reich, Trump will Amerika wieder groß machen, die AfD hat keine größeren Probleme mit Gedanken und Haltungen aus dem Dritten Reich. Das politische Personal der Gegenwart erinnert ein wenig an jene Demenzkranken, denen eine Umgebung aus ihrer Vergangenheit hilft, glücklich zu sein. Der bulgarische Autor Gospodinov dreht diesen Weg auf magische Weise um: Ein Flaneur in Vintage-Kleidung gründet Kliniken, in denen jedes Stockwerk einer bestimmten Dekade nachempfunden ist, um Alzheimer-Patienten zu befrieden. Das Konzept von Nostalgie als Hilfe geht nicht nur auf, auch die Gesunden wollen der Gegenwart entkommen. Also wird es kopiert, skaliert und zur Waffe. Erst von Konzernen, schließlich gar auf EU-Ebene, wo sich jedes Mitglied seine Lieblings-Dekade wählt (Deutschland übrigens die 80er Jahre, die Zeit von Helmut Kohl und Steffi Graf, an deren Ende alles anders wurde). Sein »Vorwärts in die Vergangenheit« spielt der Autor von Reflektionen über die erste Zigarette bis zu apokalyptischen nationalistischen und sozialistischen Aufmärschen durch – und dies auf eine unordentliche, hakenschlagende und Führung verweigernde Art. Schließlich ist die ruhige, eine Sekunde nach der anderen abrollende Zeit auch komplett aus den Fugen.
Rick Rubin: The Creative Act – A Way Of Being (Cannongate)
Wenn der Produzent, der die Beastie Boys zum Hip-Hop brachte und Johnny Cash mit den American Recordings ein fulminantes neues Leben schenkte, darüber plaudert, wie das geht mit dieser Kreativität, von der sie alle seit Ewigkeiten reden, höre ich zu. Und kann mich einfach nicht entscheiden, ob das nun – wie Nele Pollatschek in ganz anderem Zusammenhang sagte – ein »Feuerwerk unter Wasser« ist oder esoterisches Geplapper. Hilft es wirklich weiter, jeden Tag dasselbe zu tragen, weil man dann mehr Kraft für wichtige Entscheidungen besitzt? Oder ist doch das Gegenteil wahr, weil man sich von Regeln und Zäunen nicht einschüchtern lassen soll? Offenbar gehört das Luftige, das Vage zum sympathischen Spiel, man sollte sich wohl eher daran halten als an Selbstoptimierung. Der Meditationskünstler und Langbartträger Rubin fasst es jedenfalls so zusammen: »The universe never explains why.« Sowieso.
Mathias Enard: Der perfekte Schuss (Ü: Sabine Müller, Hanser Berlin)
Oha, ist dieses zwanzig Jahre alte Buch rücksichtslos. Enard schildert lediglich das Leben und Töten eines Soldaten und Heckenschützen. Wie er die ihm unbekannten Opfer obsessiv herabwürdigt. Wie auch seine Nächsten Angst vor ihm bekommen. Wie er selbst der Frau, in die er schwer verliebt ist, schließlich brutal Gewalt antut. Wie er versucht, immer wieder, ein guter Mensch zu sein oder mindestens zu werden. Doch in der Hölle Krieg gelingt ihm das nicht, er verliert auch den letzten Hauch seiner Unschuld. Enards simpler, dabei kaum aushaltbarer Trick: Er schildert alles allein aus der zunehmend entmenschlichten Ich-Perspektive. Am Ende heißt es: »Mein Kopf ist leer.« Trotz seines Alters ein vielleicht allgemeingültiges, auf jeden Fall leider aktuelles Werk.
Markus Gabriel & Renè Scheu: Sätze über Sätze – ABC des wachen Denkens (Kein & Aber)
Markus Gabriel – der den Titel »Deutschlands jüngster Philosophieprofessor« mit sich schleppt wie eine Fußfessel und der nächste Richard David Precht werden könnte – publiziert fast panisch. Fünf Werke über moralische Fortschritte, Neo-Existenzialismus und den Menschen als Tier seit 2020. Nun also Sätze, Setzungen über den Alltag, das Denken und den Zeitgeist von A bis Z. Ich bin natürlich nicht in der Lage, auch nur im Geringsten in Diskussionen mitzuhalten, ob es das Nichts nun gibt oder nicht; ob die KI als nichtlebendiges System keine Probleme hat; ob Verzicht im Bereich der Ökologie die einzige Lösung ist für Probleme, von denen man glaubt, dass man sie nicht lösen kann, oder doch ein Luxus gegenüber dem Darben; ob die Liebe gelungen ist, wenn man sich dem anderen unterwirft, ohne sich ihm zu unterwerfen. Eine Einladung zum dialektischen Flickflack ist dieses schmale Buch in jedem Fall.
Jonathan Carroll: Mr. Breakfast (Melville House)
Jonathan Carroll wird oft als writer’s writer bezeichnet. Ein vergiftetes Kompliment, bedeutet es doch, dass Verlage investieren müssen statt verdienen dürfen, weil das Publikum dieses Lob eh übersieht. »Mr. Breakfast«, sein 21. Buch (darunter ein 600-Seiten-Sammelband mit Shortstories) beweist: Der Mann macht einfach weiter – jeder nach hunderttausend Kilometern langsam eingefahrene Volvo-Motor wäre neidisch. Carroll erzählt von einem magischen Tattoo, das es einem abgehalfterten Stand-up-Comedian ermöglicht, neben des obligatorischen Werdegangs Variationen seines zukünftigen Lebens zu erleben, ohne jedoch eingreifen zu können. So zappt er sich durch Wunschvorstellungen wie Prominenz oder Kitschglück. Dann allerdings wird er gezwungen, sich doch bitte langsam mal zu entscheiden. Wie Haruki Murakami, mit dem er gern verglichen wird, ist Jonathan Carroll magischer Realist, nur deutlich besser. Härter, einfühlsamer, lustiger, auch überraschender – man schluckt also, bekommt feuchte Augen, Mundwinkel, die langsam, aber verlässlich nach oben wandern, und dann ist doch alles anders als erwartet.
Herbert Clyde Lewis: Gentleman overboard (Recovered Books)
Immer wieder gern genommen: die tragische Geschichte einer Wiederentdeckung. Lewis starb mit 41 Jahren – nach drei Roman-Flops, von seiner Frau verlassen und von seiner Tochter entfremdet – 1950 einsam in einem New Yorker Hotel, als Alkoholiker und angeblicher Kommunist auf der schwarzen Liste von McCarthy. Noch lieber gelesen: Diese Wiederentdeckung selbst, die mehr als gerechtfertigt ist. »Gentleman overboard« erzählt im ersten Kapitel davon, wie der wohlsituierte Broker Henry Preston Standish am Deck eines Frachters auf einem Ölfleck – quasi der Bananenschale der Gegenwart – ausrutscht und zwischen Honolulu und Panama im Pazifik landet. Für den Rest der Handlung treibt er im Ozean. Und das reicht? Das ist beinah mehr, als man ertragen kann: Die Hoffnung auf Rettung bewahrheitet sich nämlich nicht. Und so zerbröselt erst ein Weltbild langsam, dann ein Leben, während es woanders einfach ungerührt weiter geht. Von Preston heißt es ironisch: »He drank moderately, smoked moderately and made love moderately; in fact, Standish was one of the world’s most boring men.« Die Parallele ist klar: Einer von uns. Was diesen auch sehr komischen Roman noch böser und mitfühlender macht.
Hernan Diaz: »Treue« (Ü: Hannes Meyer, Hanser)
Die erste Fiktion: Geld. Die zweite: der Finanzmarkt, quasi wie die erste Fiktion, nur hoch zwei. Erzählt wird in Variationen von einem Börsenspekulanten und seiner angeblich labilen Gattin Mildred im New York der 1920er Jahre. Zuerst als heroischer Schlüsselroman. Dann, weil der Mann seine Frau nicht gut getroffen findet, als bruchstückhafte Korrektur. Es folgt die Perspektive der Ghostwriterin selbst, Tochter eines Anarchisten, die Dekaden später auch auflistet, aus welchen Büchern sie geklaut hat. Und schließlich Mildreds in einem Sanatorium verfasstes Tagebuch, das erneut – oder ist es das Morphium? – alles umkehrt. So, wie der Originaltitel »Trust« Vertrauen oder Konzern bedeuten kann, changieren die gut 400 Seiten – die dritte Fiktion – zwischen Dichtung und Wahrheit, erzählen vom Gestern eiskalt fürs Heute und hauen nebenbei Sätze raus wie »Gott ist die uninteressanteste Antwort auf die interessantesten Fragen.«
Charlotte Gneuß: Gittersee (S. Fischer)
Das Komma ist in der Grammatik ein Einschnitt. Diese Komma aber ist 16 Jahre alt und lebt in dem titelgebenden Dresdner Stadtteil, in welchem Uran aufbereitet, Reifen und Chemikalien produziert wurden. Aber auch sie erlebt 1976 einen Einschnitt: Ihre große Liebe soll Republikflucht begangen haben, also wird sie von der Staatssicherheit befragt. Und in ihrer ausgenutzten Hilflosigkeit angeworben. Ist Opfer und Täterin zugleich. Was ihre eh schon fragile kleine Familie – eine der Nazi-Zeit nachtrauernde Oma, eine grundgenervte Krähe als Mutter, einen überaus weichen Vater und Kommas kleine Schwester, ihr »Goldgefunkel« – aus den Angeln hebt, ein falsches Leben im Richtigen noch falscher werden lässt. Weil Charlotte Gneuß in der BRD geboren und aufgewachsen ist, gab es ein niedlich absurdes Skandälchen dazu, um die Frage, ob sie über die DDR schreiben könne – und überhaupt dürfe. Andere Autoren, die ebenfalls auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis standen, wurden nicht gefragt, ob sie der Blitz persönlich traf, auch wenn das zentraler Bestandteil ihres Romans war. Gneuß jedenfalls, die Autoren wie Ronald M. Schernikau zu ihren Vorbildern zählt, tauchte in der Shortlist nicht mehr auf. Man kann nur hoffen, dass sie das als positiven Einschnitt begreift. Und als Zeichen dafür, dass ihr strahlendes, abgründiges, lässiges, kritisches, ambivalent schwebendes und soghaft spannendes Debüt besser ist als der oft nur gepflegt öde Preis.
Rebecca F. Kuang: »Yellowface« (William Morrow)
Rebecca Kuang, in China geborene Amerikanerin und überaus erfolgreiche Autorin, schreibt einen Roman über eine junge weiße, erfolglose Autorin. Die zudem das Manuskript ihrer jungen asiatischen, extrem erfolgreichen Freundin als eigenes ausgibt, nachdem diese bei der Feier ihres Netflix-Deals an einem Pfannkuchen erstickt ist. Aus dieser Prämisse doppelter kultureller Aneignung wollte Kuang einen »lächerlichen Thriller« erschaffen, einen, der Vorbildern wie »Gone Girl« ähneln soll und sich »ein bisschen so anfühlt, als würde man einem Zugunglück in Zeitlupe zusehen«. Ist gelungen: Keine der auftretenden Figuren ist sympathisch. Die fadenscheinigen Ausreden der Plagiatorin sind grotesk unterhaltsam, als alles aufzufliegen droht. Sich daraufhin entwickelnde, ausufernde Twitter- und Goodreads-Kriege um Rassismus und Sexismus, bei denen jeder meint, die absolute Wahrheit zu kennen, nerven wie im echten Leben. Dazu gibt es bösartige, mithin wahrhaftige Einblicke in die Verlagswelt und wie Bestseller gebastelt werden. Gier, Eifersucht, Wut, Rache, Mordfantasien, alles da, nur Moral und Gerechtigkeit fehlen eben. Die Protagonistin – mal dumm, mal dreist – betreibt, selbstverständlich, Täter-Opfer-Umkehr. Aber sie lebt von Beginn an auch den Horror unendlicher Einsamkeit, da sie das kapitalistische Prinzip der Konkurrenz inhaliert hat. Und nicht an den Ereignissen reift, sondern weiter schreibt, eventuell sogar dieses Buch, wie auf Seite 266 angedeutet wird. Welches dann endlich ihre eigene, böse Geschichte wäre. Beziehungsweise eben genau nicht.
Zadie Smith: »The Fraud« (Hamish Hamilton)
Zadie Smith sagte mal, sie sei von London nach New York gezogen, weil englische Schriftsteller sonst früher oder später einen historischen Roman schreiben würden. Jetzt lebt sie wieder in London und hat gar einen viktorianischen Roman geschrieben. Er spielt 1873, handelt in extrem straffen Kapiteln von Mrs. Eliza Touchet, der schottischen Haushälterin und angeheirateten Cousine des einstmals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth, der in ihren Augen kein Talent besitzt, auch weil er historische Romane schreibt, in denen »nothing is real and nothing matters.« Im Zentrum steht zudem ein sich über Monate hinziehendes Gerichtsverfahren im viktorianischen England, ein Kampf Reich gegen Arm, Behauptung gegen Wahrheit, dessen Hauptzeuge ein Ex-Slave aus Jamaica ist – und diesen Prozess kann man, soll man wohl auch als Prequel zur Ära Trump lesen. Ich lese selten historische Romane, diesen schon. Weil kein einziger Satz altmodisch ist – und langweilig erst recht nicht. Ein Kapitel ist übrigens mit »Dickens is dead!« überschrieben. Dafür haben wir Zadie Smith.
Nele Pollatschek: »Kleine Probleme« (Galliani Berlin)
Es gibt die Theorie, dass die Zufriedenheit im Verlauf des Lebens einem U ähnelt. Lars, der Ich-Erzähler, ein 49-jähriger Hausmann und Möchtegern-Schriftsteller, ist ganz unten im U, auch weil er immer alles aufschiebt. Kurz vor Sylvester schreibt er seine To-do-Liste, welche die Struktur dieses Romans bis in die Danksagung hinein vorgibt: Er muss das Bett seiner Tochter aufbauen, die Steuererklärung machen, aufräumen sollte er auch mal und sein Lebenswerk ist noch immer ein Trümmerhaufen. Was Nele Pollatschek – laut »Die Zeit« eine der klügsten Autorinnen, die es hierzulande gibt; Herz, Hirn und Humor in einer Person meines Erachtens – aus dieser Prokrastination macht, ist eine streng subjektive, spiralförmige, aber auch seitwärts ausbrechende und saukomische Suada, die natürlich todtraurig stimmt, weil alle kleinen Probleme immer größer werden, in Richtung Politik und Philosophie mäandern. Vom Putzen etwa über Rubik’s Cube mit nur einer richtigen, aber vielen falschen Möglichkeiten zum zweiten Satz der Thermodynamik, um dann gern in einer Pointe zu versacken, weil Lars etwa weiß, dass die richtigen, die riesigen, die globalen Probleme kaum angerissen werden, auch nicht von ihm, schließlich putzen mehr Menschen als sich der Klimakrise entgegen zu stemmen, und er macht ja nicht einmal das, also: putzen. »Kleine Probleme« ist mithin der Besuch in einem kleinbürgerlichen, von der Gegenwart heillos überforderten, aber anrührenden Gen-X-Kopf. Und dann denkt man, man sollte sich mal zusammenreißen – und endlich die Dinge tun, vor denen man Angst hat.
P.S.: Nach dem nur vernichten wollenden Anschlag auf Israel am 7. Oktober – Drecksjahr, hatte ich das schon angemerkt? – hat Pollatschek eine Reihe kluger und dankenswert emotionaler Artikel und Analysen in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Dass man sie mit Gewinn gelesen hat, schafft doppelte Traurigkeit – wie schön wäre es, diese Texte wären unnötig.
www.sueddeutsche.de/kultur/was-ist-antisemitismus-documenta-warnhinweis-1.6306159
www.sueddeutsche.de/kultur/dagestan-ausschreitungen-progrom-israel-gaza-hamas-1.6295738?reduced=true
www.sueddeutsche.de/kultur/documenta-antisemitismus-deutschland-kunst-1.5612196
Helmut Ziegler, 1958 geboren, lebt in Hamburg. Zu seinen Veröffentlichungen zählen der Roman »Peng – der Penguin«, die Zitat-Sammlung »Die schönsten Film-Weisheiten« (Bd. I bis III) sowie der Genre-Klassiker »Brüste – das Buch«. Außerdem ist er Ko-Kurator des Hamburger LitLab. Im Frühjahr 2024 erscheint eventuell, möglicherweise, vielleicht, also unter Umständen sein Yoga-Thriller »Herabschauender Tod«, im Herbst »Das letzte Buch«, ein Opus voller Liebe, Leichen und Literatur.