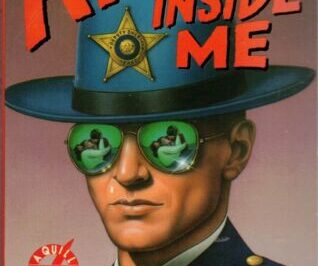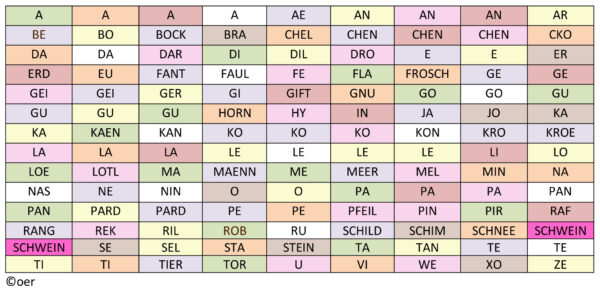Mr. Greene, you want suite overlooking Saigon River?
Mr. Greene, you want suite overlooking Saigon River?
„The Quiet American“ (1955 veröffentlicht) war Graham Greenes kritische Abrechnung mit französischen und amerikanischen Weltverbesserungs- und Großmachtfantasien, die sich in Vietnam als verheerende Realitätsverweigerung mit unberechenbarer Langzeitwirkung erwiesen. Mit dem Ich-Erzähler des Romans, dem Times-Korrespondenten Thomas Fowler, verlieh Greene einem zynisch-kritischen Reporter seine Stimme. Eindrücke aus Vietnam auf den Spuren von Graham Greene. Von Peter Münder
„Dies Land hier, das ist es, und nicht Malaya! Die Frauen … so wunderbar, so schön und elegant gekleidet. Die gesamte Situation hier ist einfach phantastisch. Man diniert hinter Gittern oder Schutzzäunen, um vor den Granaten geschützt zu sein. Gutes Essen, guter Wein und überwältigende Freundlichkeit. Ein Wagen wurde mir sofort zur Verfügung gestellt und kurz nach meiner Ankunft wurde ich von General de Lattre zum Dinner eingeladen (kein Smokingzwang). Er residiert in einem großartigen Anwesen, 200 Männer beim Wachwechsel mit Musik“. Graham Greene nach seiner Ankunft in Saigon in einem Brief an seinen Bruder Hugh vom 26. Januar 1951.
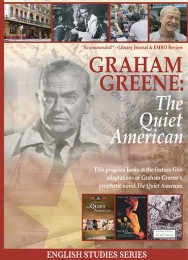 „The Quiet American“ als Wendepunkt
„The Quiet American“ als Wendepunkt
Für das US-Magazin Life hatte Graham Greene (1904 –1991) Ende 1950 eine Reportage über die kommunistischen Untergrundkämpfer in Malaya und das Ende des britischen Imperialismus geschrieben. Er war mit den hartgesottenen britischen Gurkha-Spezialeinheiten durch den Dschungel patrouilliert, um jedes gefährliche Scharmützel auszukosten; darüber hatte er noch als erzkonservativer Anhänger des Empire und der Dominotheorie berichtet: Wehe, die roten Guerillas jagen die Briten aus dem Land, dann kippen die Dominosteine in anderen bedrohten Regionen und Stalin triumphiert! Dann war Greene im Januar 1951 nach Saigon geflogen, um in einer „Paris Match“-Reportage über den französischen Indochinakrieg zu berichten. Zu der Zeit waren bereits 35.000 französische Soldaten in Vietnam gefallen. Zum exotischen Reiz Asiens, den er in Vietnam bis zum Extrem auskosten konnte, gehörten die Opiumhöhlen, die heruntergekommenen Bordelle im Chinesenviertel Cholon, in denen meistens auch ein Pfeifchen angeboten wurde und die allgegenwärtige Bedrohung durch die Vietminh, die gegenüber den französischen Truppen immer überlegener wurden und in Saigon mit Attentaten und Bombenanschlägen für zunehmende Demoralisierung der Zivilbevölkerung sorgten.
Der depressive, suizidgefährdete Greene, der von seiner großen Liebe Catherine Walston auf Druck ihres Ehemannes Lord Walston nach einer dreijährigen menage à trois vorübergehend aufs Abstellgleis manövriert worden war, verzehrte sich in Vietnam trotz der zahlreichen Gespielinnen förmlich nach ihr und hatte erheblichen Kompensationsbedarf: Neben der problematischen love affair gab es ja die verlassene katholische scheidungsresistente Ehefrau Vivien in England. Außerdem arbeitete der agnostische Hedonist Greene auch noch seit 1941 als Spion (Agent-Nr. 59200, sein Chef war damals der KGB-Maulwurf Kim Philby) für den britischen Geheimdienst SIS und berichtete über seine Gespräche und Erfahrungen, die Machtverhältnisse in Vietnam oder über „Uncle Ho“ und dessen Umfeld, als er Ho Tschi Minh 1955 in Hanoi für die Sunday Times interviewte. Die Franzosen hatten den schreibenden Freizeit-Spion wegen dubioser Kontakte zum militanten, einflussreichen Bischof Lee Huu Tu und dessen eigener Armee bereits im Visier und ließen ihn beschatten. Kein Wunder, dass der Autor von „Der Dritte Mann“ reichlich Wein, Whisky und Champagner konsumierte und sich beim Puffbesuch nur selten mit vier Pfeifen Opium begnügte.
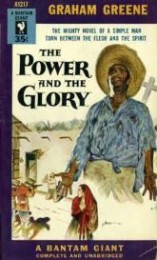 Der Kriegsreporter Greene stürzte sich auch begeistert ins Schlachtgetümmel, machte als Kopilot einen französischen Kampfeinsatz und eine Bombardierung außerhalb von Hanoi an der chinesischen Grenze mit und registrierte genau, wie der Pilot nach dem Einsatz noch beiläufig mehrere Salven auf einen völlig harmlosen Sampan und dessen Besatzung abfeuerte, die diese Attacke wohl nicht überlebte. Der vom exotischen Reiz und dem unvergleichlichen Nervenkitzel begeisterte Autor besuchte daher auch in den folgenden Jahren immer wieder Vietnam. Es war für ihn eine überlebenswichtige Droge, auf die er einfach nicht verzichten konnte. Und Vietnam war auch in literarischer Hinsicht ein Erweckungserlebnis: „The Quiet American“ markierte nämlich den entscheidenden Wendepunkt, der dazu führte, dass Greene statt verschwiemelter krypto-katholischer Betroffenheitsergüsse wie die des Whisky-Priesters in „The Power and the Glory“ (von 1940) nun lieber politische Konflikte oder die egomanischen Exzesse brutaler Despoten realistisch (auch satirisch in der Geheimdienst-Posse „Unser Mann in Havanna“) und mit prophetischer Weitsicht thematisierte.
Der Kriegsreporter Greene stürzte sich auch begeistert ins Schlachtgetümmel, machte als Kopilot einen französischen Kampfeinsatz und eine Bombardierung außerhalb von Hanoi an der chinesischen Grenze mit und registrierte genau, wie der Pilot nach dem Einsatz noch beiläufig mehrere Salven auf einen völlig harmlosen Sampan und dessen Besatzung abfeuerte, die diese Attacke wohl nicht überlebte. Der vom exotischen Reiz und dem unvergleichlichen Nervenkitzel begeisterte Autor besuchte daher auch in den folgenden Jahren immer wieder Vietnam. Es war für ihn eine überlebenswichtige Droge, auf die er einfach nicht verzichten konnte. Und Vietnam war auch in literarischer Hinsicht ein Erweckungserlebnis: „The Quiet American“ markierte nämlich den entscheidenden Wendepunkt, der dazu führte, dass Greene statt verschwiemelter krypto-katholischer Betroffenheitsergüsse wie die des Whisky-Priesters in „The Power and the Glory“ (von 1940) nun lieber politische Konflikte oder die egomanischen Exzesse brutaler Despoten realistisch (auch satirisch in der Geheimdienst-Posse „Unser Mann in Havanna“) und mit prophetischer Weitsicht thematisierte.
Diese Entwicklung von einer apathisch-zynischen Perspektive („Laß sie kämpfen, laß sie lieben, laß sie morden, ich habe mich da immer herausgehalten“) hin zum kritischen Engagement vollzieht Fowler erst nach Phasen massiver Zweifel: Anfangs registrierte er Pyles unbedarft-naive Schwärmerei für einen „Dritten Weg“ noch mit milder Nachsicht als fehlgeleitete These eines übereifrigen Dummkopfs, der sich von den Traktaten des oberschlauen US-Leitartiklers York Harding geradezu hypnotisieren ließ.
Doch nach dem Blutbad am Lam Son-Platz vor dem Stadttheater, das Pyle als Spezialist für Plastikbomben mitgeplant hatte, begreift er, dass er diesem naiven, aber gefährlichen Tropf, der für seine vorgefasste Ideologie Menschenleben opfert, ein Ende bereiten muss. Daher lässt er Pyle in eine Falle laufen und toleriert das von den Vietminh verübte Attentat auf Pyle. Das vermeintliche Happy End mit der zu Fowler zurückgekehrten Phuong ist mit den typischen emotionalen Greene-Attributen behaftet: Eher larmoyant, voller Schuldgefühle und Selbstzweifel wird Fowler mit einer Zukunft konfrontiert, die sich vom gegenwärtigen düsteren Depressionsszenario kaum unterscheiden dürfte. Ihn erleichtert allerdings sein radikaler Entschluss, sich für die richtige Seite entschieden zu haben, „weil man menschlich bleiben will“. Fowler versucht, seine Vorbehalte gegenüber dem Amerikaner zu erklären: „Wir sind zwar die alten Kolonialisten, Pyle, aber wir haben doch etwas von der Realität gelernt – nämlich nicht mit dem Feuer zu spielen. Diese „dritte Kraft“ – die gibt es doch nur in einem Buch, das ist alles. General The ist doch nur ein Bandit mit einigen Tausend Soldaten: Er verkörpert nicht die nationale Demokratie“.
Während der lethargische Fowler letztlich doch berührt ist vom individuellen Schicksal und alle Ideologien als abstrakte Planspiele verdammt, erkennt er in Pyle den Schreibtischtäter, Thesen-Ritter und Weltverbesserer, der nichts begriffen hat, aber alles besser weiß und nicht locker lässt im Bemühen „Gutes zu tun, nicht einer einzelnen Person, sondern einem Land, einem Kontinent, einer Welt“. LBJ, Nixon, George W. Bush: Waren sie nicht auch alle „stille Amerikaner“, die „Gutes tun“ wollten und dafür andere Länder mit vermeintlich dubiosen Gesellschaftssystemen in Schutt und Asche bomben ließen? Als George W. Bush im August 2007 vor Kriegsveteranen in Kansas City sprach, zitierte er übrigens Graham Greene und dessen „Quiet American“ und berief sich, verquast wie eh und je, auf Alden Pyle als Inkarnation des idealen Neokonservativen: „Der junge Regierungsbeamte Alden Pyle war Symbol des amerikanischen Idealismus und Patriotismus“, behauptete er. Und Fowlers Kritik am naiven, unbelehrbaren und selbstherrlichen Weltpolizisten-Habitus Pyles (Fowler: „Nie habe ich einen Mann kennengelernt, der für den Ärger, den er verursacht, bessere Beweggründe besitzt“) begriff Bush als Rechtfertigung einer noblen, neokonservativen Gesinnung. Wir haben es geahnt: Wenn Mr. Bush schon mal ein Buch liest, dann kann dabei nichts Gutes herauskommen.
Der „stille“, unauffällige Amerikaner Pyle ist ein Repräsentant der Berater- und Funktionärskaste: Er hat immer einen Plan für alle Fälle dabei; war er nicht das Vorbild von Sicherheitsberater Colin Powell, der mit einem schönen, übersichtlichen Plan vor die UNO trat, auf dem alle angeblich existierenden Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein verzeichnet waren, um den sofortigen Überfall auf den Irak zu rechtfertigen? Oder um eine Invasion in Afghanistan durchzuführen und das Land für eine „systemrelevante“ Struktur-Optimierung in die Steinzeit zurückzubomben? Der Technokrat Pyle bietet auch an, Phuong und ihrer skeptisch-puritanischen Schwester eine Gesundheitsbescheinigung, Blutgruppenbescheinigung usw. vorzulegen: Da hat er gerade erst Fowlers Geliebte Phuong kennengelernt, die er heiraten will – er liebt sie nicht, aber wenn sie später heiraten und Kinder kriegen, dann muss man eben rechtzeitig alle Risiken ausschließen. Die Hochzeit soll natürlich in den USA stattfinden. „Und am Weekend geht es dann nach Coney Island?“ spottet Fowler.
Graham Who???
In Saigon (nur Bürokraten und Parteifunktionäre nennen es HCMC/Ho Chi Minh City) wohnte Greene meistens im traditionellen, 1880 gebauten Hotel Continental am Stadttheater oder im mondäneren Majestic Hotel (von 1925) am Saigon River. Beide Luxushotels sind durch die Rue Catinat miteinander verbunden, die im „Quiet American“ mehrmals erwähnt wird, jetzt aber in Dong Khoi Street umbenannt ist. Fowler wohnt in der Rue Catinat, wo ihn auch seine vietnamesische Geliebte Phuong regelmäßig besucht.
Das Continental hat zwar keine Außen-Terrasse mehr, weil Parteifunktionäre vor einigen Jahren den Warenverkauf im Außenbereich (dazu gehören auch Essen und Getränke) verboten haben, es besitzt aber nach wie vor seinen klassischen traditionellen Baustil. Die Zimmer haben Deckenventilatoren, Klima-Anlage und Flachbild-TV, die Badezimmer-Armaturen stammen aber offenbar noch aus der französischen Kolonialzeit. Jedenfalls deuten die französischen Abkürzungen auf den altmodischen Porzellan-Hähnen für „Warm“ und „Kalt“ darauf hin.
Der altbewährte Charme zeigt sich schon beim Frühstück, das man im Innenhof unter einem prächtigen riesigen Baum einnehmen kann: Denn am Büffet kann man einen wunderbaren britischen Uralt-Toaster in Betrieb nehmen, der mit einem Kettenantrieb ausgerüstet ist und die Toastscheiben wie am Fließband über glühende Drähte rotieren lässt: Der Apparat spuckt die perfekt gerösteten Scheiben nach kurzer Zeit am hinteren Ende wieder aus – solide alte Technik, die einem das Herumfingern in den glühenden Innereien erspart. Nicht erspart wurde den Gästen aber zum Valentinstag das dümmliche Valentins-Brimborium: Die pinkfarbene „Happy Valentine“-Dekoration an der Hotelfassade, die Spezial-Arrangements inklusive Valentine-Dinner – der „stille Amerikaner“ wäre sicher begeistert gewesen und hätte diesen Kitsch als großartige kulturelle Errungenschaft goutiert.
Da wir uns als Greene-Forscher wie schon GG ebenfalls im Continental einquartiert hatten und im Foyer einige alte Fotos aus der Kolonialzeit erspähten, die an die Epoche der „Grande Nation“ erinnern, gehörte es natürlich zur Pflichtübung, Greene-Memorabilia zu eruieren: Gab es im Hotel irgendwelche Bilder, Souvenirs, Hinweisschilder oder eine Suite, die wie im Oriental Hotel in Bangkok an VIP-Gäste wie Joseph Conrad oder John le Carré erinnern? Das wollte ich von den Mädels an der Rezeption wissen: „Mister Who?“ lautete die Antwort – von Graham aus Great Britain hatte noch niemand etwas gehört.
Das war andererseits nicht allzu überraschend, denn mit der heroischen Vergangenheit, mit dem Sieg über die Yankees haben die Vietnamesen kaum noch was am Hut. Das interessiert offenbar nur noch verkalkte Museumsbesucher oder abgeklärte Alt-68er aus Europa? Dagegen scheinen die amerikanischen Errungenschaften der Gegenwart – Apple, Nike, Hollywood, Kentucky Fried Chicken und Burger-Ketten, vor allem auch schmalziges und blutrünstiges Trash-TV – hier dermaßen bewundert und verehrt zu werden, dass man den Eindruck gewinnen könnte, die Amis hätten den Krieg gewonnen und die Vietnamesen hätten ihnen das US-Kulturverständnis begeistert entrissen, um es völlig unkritisch zu übernehmen. Die Heldenverehrung für Onkel Ho scheint eher eine ritualisierte Pflichtübung zu sein. „Nur nicht nach hinten blicken“ lautet hier schlicht und einfach das Motto – wen interessiert schon so ein längst verstorbener Schreiberling ? Wir steigern lieber volldynamisch das Bruttosozialprodukt!
Das ist aber genau das Problem: Was kann man schon sechzig Jahre nach Greenes Vietnam-Phase entdecken, das nach zwei gewaltigen Befreiungskriegen noch an diese Epoche erinnert oder historische Zusammenhänge offenbart, die heute auch noch aktuell sind? Ist unter den ominösen vietnamesischen Bedingungen einer sozialistischen Volksrepublik, die voll auf turbokapitalistische Raffgier und Rendite setzt und Parteifunktionäre hat, die sich mit korrupten Machenschaften die Taschen vollstopfen, überhaupt noch eine Orientierung über gegenwärtige vietnamesische Verhältnisse möglich? Überall sind Geschäfte, Hotels und Wohnungen mit WLAN und TV ausgestattet, doch die Zensur verbietet Facebook – was die meisten Vietnamesen allerdings mit einem trickreichen Ausweg über ausländische Links umgehen. Und die Pressefreiheit ist in einer ähnlich bedrohten Lage wie in China: Wenn Journalisten über Korruption unter Parteifunktionären berichten, wie etwa Nguyen Viet Chin und Nguyen van Hay, die über die Verstrickungen von Parteifunktionären in einen Korruptionsskandal berichteten, dann werden sie einfach zu zwei Jahren Haft und Umerziehung verurteilt.
Aus unserem Zimmer im Continental haben wir zwar einen herrlichen Blick auf das Stadttheater und dessen prächtige klassische Säulen-Architektur, auch die vor dem Hoteleingang parkenden Fahrrad-Rikschas wirken ganz malerisch. Aber dieser Lärm! Im Stockwerk unter uns wird gebohrt, gehämmert, gesägt – fast rund um die Uhr. Dazu dann die Außenbeschallung der im Dauer-Hupen-Modus herumflitzenden Mopeds – absolut nervtötend. Man kann auch kaum eine Kreuzung im normalen Tempo überqueren, weil der Strom der Zweiräder ununterbrochen fließt und sich vor Zebrastreifen sogar noch beschleunigt. Immerhin gibt es gelegentlich gutmütige Samariter, die einem Fußgängerpulk entschlossen voranmarschieren und mit erhobenen Armen die Zweirad-Armada zur Vorsicht ermahnen. Da sich hier alles im Freien abspielt und fliegende Händler, Imbissbuden und Restauranttische auf den Fußwegen postiert sind, muss man wie ein hakenschlagender Hase um alle Hindernisse herumkurven.
Das hat aber auch Vorteile: Es entgeht einem nämlich auch im schnellen Stolperschritt keins der vor die Nase gehaltenen Sonderangebote. Schon beim ersten Gang durch die Dong Khoi Street hinunter zum Fluss entdeckte ich einen vietnamesischen Raubdruck einer Reportage der britischen Reporter Tom Mangold und John Pennycate über die legendären Cuchi-Tunnel, in denen die Vietkong die schlimmsten US-Bombenangriffe überlebten. Die Cuchi-Tunnel-Touren gehören inzwischen zum touristischen Standardprogramm. Und neben Zigaretten, T-Shirts mit dem üblichen „Good Morning Vietnam“-Aufdruck und Kaugummis hatten die meisten Händler auch Raubdrucke von Greenes „Quiet American“ im Angebot – ein gutes Zeichen, denn offenbar gibt es immer noch Touristen, die auch lesen und nicht nur auf Handy-Displays starren, unentwegt simsen oder Facebook-hörig sind. Allerdings ist dann das lange Gefeilsche um sechs oder sieben Dollar für so einen Raubdruck (hallo Piraten!), in dem die alten Fotos nicht mehr zu erkennen sind, ziemlich anstrengend. Das Sortiment ist übrigens sehr differenziert und anspruchsvoll: Auch der Band „Vietnam Now“ des US-Reporters David Lamb wird günstig angeboten – Lamb berichtete für amerikanische Medien vom Vietnamkrieg, blieb beim Fall Saigons in der Stadt und schrieb darüber für die LA Times. 1997 übernahm er als LA Times-Korrespondent die Leitung des Hanoi-Büros.
Ende des erste Teils, lesen Sie bitte am Mittwoch weiter …
Peter Münder
Abbildung Green: Forgács Máté, hier geht es zur Quelle.
Mehr zu Graham Green hier.
Graham Greene: The Quiet American. Penguin 20th Century Classics, 1973
Norman Sherry: The Life of Graham Greene. London: Jonathan Cape 1994 (vol. 2, 1939-1955).
Michael Shelden: Graham Greene: The Man within. London: Heinemann 1994.
Julia Llewellyn Smith: Travelling on the Edge. Journeys in the Footsteps of Graham Greene. New York: St. Martin’s Press 2000.
James Fenton: All the wrong places. London: Penguin Books 1988.